Korg microKorg, wahre Synthesizer-Liebe
Zum microKORG kam ich wie die Jungfrau zum Kinde. Nach jahrelangem Wunsch, mal einen richtigen Synthesizer zu besitzen, war der Kauf eines alten Analogen für mich damals zu heikel und die gebrauchten Digitalen hatten so ihre Altersschwächen oder ihre Preise lagen jenseits von dem, was ich als Experiment dafür ausgeben wollte. Als ich dann zufällig einen Amazona-Artikel über dieses kleine Wundergerät las, war er bereits 10 Jahre am Markt und musste schnellstmöglich geordert werden. In meinem Artikel zur MPC Renaissance erwähnte ich bereits, dass ich hochgradig sehbehindert bin und mir der PC-Hype Ende der 90er Jahre etwas die Lust am Musikmachen aufgrund vieler Bedienungsprobleme nahm. Im KEYS-Magazin, dessen Heft-CD ich regelmäßig hörte, wurden auch fast nur noch Software-Instrumente vorgestellt, so entging mir völlig der Bericht zum microKORG, den ich später hier in meinem CD-Archiv fand. Fast ärgerlich, denn so ein Gerät hätte mir damals sicher meine Freude am Musizieren erhalten können. Warum mich das Gerät so begeistert, liegt an meinen persönlichen Erfahrungen, die ich an dieser Stelle skizzieren möchte.
Es mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein, dass mir die Marken KORG Und Roland für Synthesizer früher fast ausschließlich Begriffe waren und ich die alt ehrwürdigen Pioniere Moog, ARP, Sequencial, PPG und wie sie alle hießen gar nicht kannte. Das liegt darin begründet, dass ich vor dem Informationszeitalter nicht einfach eine Zeitschrift kaufen und lesen konnte, es blieb höchstens der Instrumentenbeschau im Kaufhaus übrig. Doch hier standen vorwiegend Heimorgeln und Keyboards von CASIO oder Yamaha. Synthesizer fanden sich in Spezialgeschäften, zu denen ich damals noch keinen Zugang hatte. Als einziger Berührungspunkt blieb hier unsere Schule, das Landesbildungszentrum in Hannover schaffte sich einen DW-8000 an, später in Marburg lernte ich weitere Synthesizer kennen. Einem liebenswerten Musiklehrer ist es zu verdanken, dass ich auch außerhalb der Unterrichtszeiten Zugang zu unseren Musikalien hatte, dort gab es viele Instrumente, unter anderem einen KORG Poly800, der etwas ganz besonderes war. Dieser wurde mithilfe eines sprechenden Panasonic-Taschenrechners von unserem Elektroniklabor so umgebaut, dass die drei zweistelligen Segmentanzeigen mit je zwei Tasten versehen wurden. So konnte man den Ziffernwert im Display per Sprache ansagen lassen. Trotz Sehrest war das phänomenal und ich weiß gar nicht, ob Schüler ihn überhaupt programmiert haben. Das begeisterte mich auch am DW-8000, drei Anzeigen mit eindeutigen Ziffernwerten, 64 Parameter und eine schnelle Dateneingabe. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal in den Genuss eines DW-8000, um ihn mit meinem heutigen Wissen ausführlich testen zu können.
Kommen wir nun zum microKORG, denn als dieser Anfang des letzten Jahrzehnts auf den Markt kam, waren die meisten Geräte nicht mehr mit Segmentanzeigen, sondern mit sich vollständig ändernden Punktmatrix-Displays ausgestattet. Dabei ist es erstaunlich, dass sich dieses Instrument trotzdem noch großer Beliebtheit erfreut, zumal die Nachfolger XL und XL+ sich von dieser Anzeige verabschiedet haben. Zurecht las ich auch hier in manchen Tests den Hinweis, dass solche Displays nicht mehr zeitgemäß sind, mich erfreuen sie aber ob ihrer einfachen Struktur und waren beim microKORG das alles entscheidende Kaufargument. Allerdings lässt er sich ohnehin nur schwer mit microKORG XL und XL+ vergleichen, weil diese doch ein ganz anderes Konzept anbieten. Sie versuchen wie Rolands kleine Junos eher, Naturinstrumente zu imitieren und bieten dazu auch entsprechende Grundwellenformen an, achtstimmige Polyphonie lassen sie auch mehr praxistauglich erscheinen. Der microKORG hingegen beschränkt sich auf die klassische VA-Synthese und bietet die aus dem DW-8000 bekannten DWGS-Wellenformen als nettes Beiwerk an. Mit diesen kann man auch realistischere Instrumente erzeugen, ein Clavinet oder DX-7 E-Piano wird dadurch möglich und klingt auch warm und gut, wenn auch nur mit vier Stimmen.
Ich denke nicht, dass ich hier den grundsätzlichen Syntheseaufbau noch groß skizzieren muss, zwei Oszillatoren mit Rauschgenerator (wobei der erste deutlich flexibler einsetzbar ist und sich der zweite nur auf die Grundwellenformen beschränkt), dazu die klassischen Filtertypen, ADSR-Hüllkurve und zwei LFOs und die Möglichkeit, über eine Art virtuelles Patchfeld einige Klangverbiegungen zu realisieren. Ein 8-Band-Vocoder inklusive Mikrofon, Audioeingang, MIDI und Audioausgang runden das Paket ab. Würde ich ihn nicht kennen und man würde ihn mir mit der Frage in die Hand geben, in welchem Jahr das Gerät hergestellt wurde, ich hätte wohl 1982 gesagt. Denn er fühlt sich auch absolut so an und die helle Rückseite aus diesem fast glatten Kunststoff, das erinnert wahrlich nicht an das letzte Jahrzehnt. Dazu hätte er pechschwarz sein müssen, vor Allem auch runde, schwarze Drehpotis mit weißer Nase. Selbst die Metallplatte auf der Oberseite und der etwas labberig wirkende Batteriedeckel scheint eher von einem 80er-Jahre-Gerät zu stammen. Ich möchte mal wissen, ob KORG damals wohl auch eher den Zeitgeist früh erkannt hat oder sich jemand einfach mal verwirklichen wollte. Wie auch immer, es ist gelungen und dass er immer noch erhältlich ist, spricht doch klar für das Konzept. Wäre er Anfang der 90er oder Ende der 80er Jahre auf dem Markt erschienen, hätte man KORG wohl damals ausgelacht.
Was ist also der Charme des microKORG? Ich würde meinen, der konzeptionelle Gedanke an die 80er Jahre. Was er nämlich nicht gut kann, sind zeitgemäße Dance-Sounds, die man heute auf jedem Pop-Sampler hört. Auch kann er keine zeitgemäß authentischen E-Pianos und erst recht kein Klavier emulieren oder als knarziges Hammond-Plagiat nützen. Er ist einfach Synthesizer und bietet recht warme, aber nüchterne Sounds verschiedenster Genres vergangener Tage. Zwar auch mit Durchsatzkraft, aber immer doch mit der virtuellen Handschrift eines vergangenen Instruments.
Und das sieht man auch beim Bedienkonzept, das so ohne Menüstruktur ganz anders und klar gegliedert ist, wie es wohl fast nur die analogen Vertreter richtig können. So zeigt das dreistellige Display zumeist einen Parameterwert auch in Form eines Namens an, wobei dieser auf drei Buchstaben abgekürzt wird, diese sind auch für mich nicht immer eindeutig. Im Kontextbezug kann man aber schon erkennen, was das Instrument von einem will. On und Off sind da schon die einfacheren Begriffe. Rechts am Instrument befindet sich eine Art Gatter oder Koordinatensystem, auf dem die einzustellenden Werte ablesbar sind. Für mich sehr praktisch, die kann ich nämlich (zumindest die für mich gängigsten) auswendig lernen. Dabei wird bei der Beschriftung zwischen Synthesizer und Vocoder unterschieden, diese hat man auch farblich abgegrenzt und eine jeweilige LED informiert, ob nun Synthesizer- oder Vocoder-Parameter geändert werden. Auf der X-Achse oberhalb befinden sich die fünf Drehregler zur Parameter-Eingabe, die Y-Achse bestimmt, welche bis zu fünf Werte die Regler nun verändern. Links daneben lässt sich mit zwei an Knebelschalter erinnernden Drehregler der Parameter-Block einstellen. Es sind zwei Regler, da einer wohl nicht alle Parameterreihen abfahren könnte. Der obere steuert die grundsätzlichen Programmparameter, der untere das virtuelle Verschalten und globale Parameter, wie Effekt, Arpeggiator und MIDI. Leicht kompliziert wird es, wenn der obere Schalter auf Filter steht, der untere auf Effekt und man möchte nun doch noch Einstellungen am Filter verändern. Dann muss man einfach den oberen eine Position verschalten und dann wieder zurück, um auf die Reihe mit den Filterwerten zu kommen.
Klingt vielleicht etwas kompliziert, aber daran kann man sich ganz leicht gewöhnen. Die oberen Regler sind keine Endlosregler, somit muss man bei einer Parameteränderung den Wert zunächst abholen, sie umfassen 128 mögliche Werte. Wird ein Instrument aufgerufen und keiner der Parameterschalter gedreht, werden standardmäßig unter Anderem Filter, Resonanz und Arpeggiatorgeschwindigkeit verändert, die Funktionen sind auch schön auf dem Instrument beschriftet. Wer jetzt meint, man könne im Live-Spiel schön sanft den Filter auf und zu drehen und hätte ein analoges Feeling, der irrt. Denn diese Freude wird durch die Rasterung der Drehpotis getrübt. Allerdings laufen die Filter sehr sanft, wenn der LFO diese steuert und wirken dann schon sehr analog. Es sei auch noch zu erwähnen, dass die Filterresonanz nicht so kräftig kreischt, wie man es von einem Monotribe gewohnt ist, daher ist der microKORG weniger was für aggressive Sounds.
Der Rest der Bedienung ist nicht ganz so trivial, denn ich musste erst das Referenzhandbuch studieren, bis ich überhaupt wusste, wie man den Schreibschutz aufhebt oder das Programm initialisiert. Das passiert nämlich mit acht Funktionen, die sich unter der Reihe der „PROGRAM NUMBER“-Tasten verstecken. Diese stellen in Verbindung mit Shift nämlich eine Zweitfunktion bereit, wobei KORG Hier auch mitgedacht hat. Der erste Druck einer Programm-Taste mit Shift zeigt dessen Funktion an, der zweite Druck löst diese aus. Somit ist man hier mit dem Drei-Buchstaben-Code auf der Haben-Seite und kann zumindest nicht versehentlich ein Programm mit Shift+3 (Initialisieren) löschen. Viel einfacher geht das Auswählen eines Sounds: Mit dem Programmwahlschalter (mit eher irreführender Kategoriebeschriftung, die man auch ignorieren kann) wählt man die Kategorie und drückt einen der acht Tasten, kann zudem mit A/B noch die Variation wählen und kommt so auf 128 Sounds. Aber Vorsicht ist geboten, denn das geht auch genauso einfach, wenn man einen Sound programmiert. Wenn man diesen nämlich nicht abspeichert und man drückt eine der Programmtasten, ist er verloren. Darüber tröstet jedoch hinweg, dass das Speichern mit der Write-Funktion ebenso einfach ist. Auch wenn man vielleicht eine andere Soundbank bevorzugt, kann man diese vor dem Speichern noch umschalten. Erst Drücken auf eine Programmtaste überschreibt den aktuellen Sound. Aber auch die anderen Tasten in Verbindung mit Shift bieten Zweitfunktionen, es lassen sich zwei Timbres programmieren und auch layern, manche der Werks-Presets nutzen dies auch aus. Dadurch wird der microKORG zwar nur noch zweistimmig, aber solo ließen sich im Unisono-Modus beider Timbres acht Oszillatoren auf einen Tastendruck anspielen. Verteilt man diese noch ins Stereobild, kann man schon einen fetten Lead-Synth programmieren.
Die Mini-Tastatur mit 37 Tasten und Anschlagsdynamik halte ich für absolut zweckdienlich, gleiches gilt auch für die seitlichen Räder, die auch programmierbar sind. Der Arpeggiator als Spielhilfe ist sehr flexibel und ermöglicht auch mit einer Lauflichtprogrammierung rhythmische Verläufe, denn Noten können komplett ausgelassen werden. Pro Sound kann ein eigener Arpeggiator programmiert werden, auch lässt sich der Tastaturbereich mit abspeichern. Will man Parameter sichern oder ins Instrument laden, gibt es einen kostenlosen Soundeditor oder man kann dies auch über SysEx direkt von einer DAW aus machen. USB hat er nicht, aber das hat mir auch noch nie wirklich gefehlt. Es ist einfach ein Instrument zum Spaß haben oder für Live-Gigs und weniger konzipiert für das Studio. Und auch wenn es USB im Jahre 2002 schon gab, könnte der Rotstift auch ein Argument gewesen sein, denn damals war die Realisation von USB-Anschlüssen noch deutlich aufwendiger.
Das Audiobeispiel hatte ich für einen Podcast erstellt, in welchem ich den microKORG besonders für blinde und sehbehinderte Musiker hervorgehoben habe. Es ist eine Mischung zum Teil aus dem Demo-Songs und wurde im Overdoubing-Verfahren mit einem Olympus LS-100 erstellt.

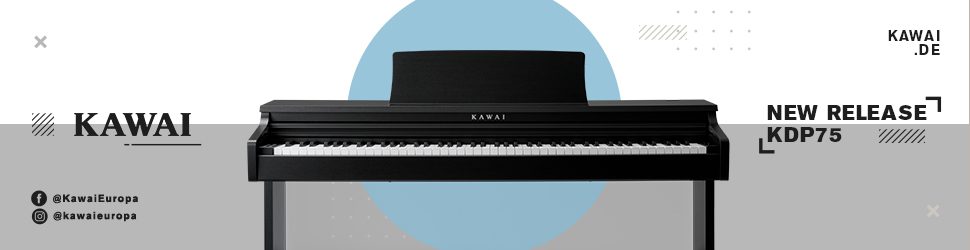












schöner Erfahrungsbericht, war angenehm zu lesen.
Sind eigentlich die unterschiedlichen Farbmodelle noch erhältlich, weißt du da was?
mfG
Hi und danke für Deine Resonanz. Die Farbmodelle waren bei den Thomännern lange Zeit gelistet, trotz dass sie limittiert sind. Aber limittiert heißt ja heute mitunter auch mehrere tausend Stück. Aber ich habe diese schon länger nicht mehr gesehen. Das war ja zum 10jährigen Jubiläum des microKORG mal gemacht worden, auch vom XL gab es ja verschiednee Varianten. Auf der Musikmesse lag zumindest, soweit ich das noch in Erinnerung habe, der normale herum. Den finde ich auch mit am schönsten, eben so rustikal.