AMAZONA.de-Autor Michael Schill: 10 Alben, die meine Geschichte mitgeschrieben haben
 Ich muss gestehen: Vor ein paar Jahren habe ich meine Plattensammlung verkauft. Daher gibt es hier leider (mit einer Ausnahme) auch keine Fotos meiner Lieblinge zu sehen. Nachdem ich schon viele Medienbrüche im Musikbereich erlebt habe (LP, MC, CD, MD – you name it), fand ich es an der Zeit, mich vom Materiellen zu lösen. Denn so schön es auch ist, die Original-Single von Kraftwerks Kometenmelodie (1973) in Händen zu halten, die ich dereinst von meiner jüngsten Tante „vererbt“ bekam, lebt die Musik doch auch ohne Tonträger weiter. Und damit meine ich nicht nur auf Spotify und MP3, sondern in unseren Emotionen und Erinnerungen, unserer jeweiligen persönlichen Geschichte. Meine soll hier anhand von 10 Alben erzählt werden – na, das kann ja was werden …
Ich muss gestehen: Vor ein paar Jahren habe ich meine Plattensammlung verkauft. Daher gibt es hier leider (mit einer Ausnahme) auch keine Fotos meiner Lieblinge zu sehen. Nachdem ich schon viele Medienbrüche im Musikbereich erlebt habe (LP, MC, CD, MD – you name it), fand ich es an der Zeit, mich vom Materiellen zu lösen. Denn so schön es auch ist, die Original-Single von Kraftwerks Kometenmelodie (1973) in Händen zu halten, die ich dereinst von meiner jüngsten Tante „vererbt“ bekam, lebt die Musik doch auch ohne Tonträger weiter. Und damit meine ich nicht nur auf Spotify und MP3, sondern in unseren Emotionen und Erinnerungen, unserer jeweiligen persönlichen Geschichte. Meine soll hier anhand von 10 Alben erzählt werden – na, das kann ja was werden …
Wie bei so vielen Synthie-Freaks meiner Generation war es die Fernsehwerbung für Jean Michel Jarres Oxygene (1976), Equinoxe (1978) und Magnetic Fields (1981), die mir neue Welten eröffnet hat. Und doch stellten diese Alben nur einen ersten Einstieg dar. Was nämlich Anfang der 80er-Jahre dann innerhalb kurzer Zeit aus New Wave und Neuer Deutscher Welle hereinschwappte, kühl, düster, politisch und frech, wirkte wie ein musikalischer Paradigmenwechsel, in dem ein Heranwachsender, der in der Zeit der Revolte geboren und in den anfangs bunten, später immer bleierner werdenden 70er-Jahren aufgewachsen war, eine neue Identität finden konnte. Der Casio VL-1 war denn auch mein erstes elektronisches Musikinstrument – nur schade, dass ich noch zu jung war, um wie Trio damit in der ZDF-Hitparade aufzutreten. Ich hörte die deutschsprachigen Eintagsfliegen der NDW sowie Eurythmics, Tears For Fears, Icehouse, Human League, Thomas Dolby und Howard Jones (dessen „Hide And Seek“ ich heute noch liebe) im SWF3 „Pop Shop“, bis ich eines Tages eine Mitgliedschaft im „Club Center“ von Bertelsmann bekam, bei der jedes Quartal eine Langspielplatte zum vergünstigten Preis zu erwerben war.
Ultravox – Rage In Eden (1981)
Vertreibung aus dem Paradies
 Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde, als ich den Verkäufer bat, in die Platte mit dem altrömisch wirkenden Artwork (Design: Peter Saville) „reinhören“ zu dürfen. Als sich die Nadel senkte, traf mich die Musik unter dem Kopfhörer bis ins Mark, denn sie war anders als alles, was ich bisher gehört hatte. Da waren die Synthesizer, aber sie klangen nicht kosmisch und verträumt, sondern wie Maschinen. Da war das Treibende aus Synth-Pop und New Wave, aber ohne alles Verspielte und Positive (selbst Depeche Mode war zu Zeiten von „Speak & Spell“ ja quasi noch eine Gute-Laune-Band). Und auch das Orchestrale erster Hörerfahrungen aus den Siebzigern wie bei Alan Parsons Project war vergessen, alles war „stripped-down“ und trotzdem voller Dramatik. Die musikalische Formel von Ultravox hatte mich voll erwischt, jahrelang war ich ein absoluter Fanboy. Die ganze Band habe ich leider erst 2009 bei ihrer Reunion live gesehen – wobei der Bezug auf meine erste Platte bei der „Return to Eden“ Tour natürlich die Reminiszenz schlechthin war. Ihre letzte Tour zum „U-VOX“ Album im Winter 86/87 verpasste ich, weil unser Citroen GS es im Schneetreiben nicht aus dem Allgäu nach Stuttgart schaffte. Dafür habe ich nach der Auflösung alle Spin-offs weiter verfolgt: Billy Curries Alben wie „Transportation“ (1988) und auch die ganzen Solo-Konzerte von Midge Ure, die ohne den Genius seiner Mitstreiter am Ende nur noch etwas Singer-Songwriter-Charme hatten. Auch den historischen Wurzeln ging ich nach: die drei Alben mit John Foxx (unvergessen: die erste Scheibe mit „I Want To Be A Machine“) und dessen Solo-Platten, die Visage-Alben und natürlich Conny Plank, in dessen Studio nahe Köln (auf der Rückseite des Covers vermerkt) Rage In Eden entstanden ist. Ultravox hatte mich aus dem Paradies meiner Kindheit vertrieben, es führte kein Weg mehr zurück.
Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde, als ich den Verkäufer bat, in die Platte mit dem altrömisch wirkenden Artwork (Design: Peter Saville) „reinhören“ zu dürfen. Als sich die Nadel senkte, traf mich die Musik unter dem Kopfhörer bis ins Mark, denn sie war anders als alles, was ich bisher gehört hatte. Da waren die Synthesizer, aber sie klangen nicht kosmisch und verträumt, sondern wie Maschinen. Da war das Treibende aus Synth-Pop und New Wave, aber ohne alles Verspielte und Positive (selbst Depeche Mode war zu Zeiten von „Speak & Spell“ ja quasi noch eine Gute-Laune-Band). Und auch das Orchestrale erster Hörerfahrungen aus den Siebzigern wie bei Alan Parsons Project war vergessen, alles war „stripped-down“ und trotzdem voller Dramatik. Die musikalische Formel von Ultravox hatte mich voll erwischt, jahrelang war ich ein absoluter Fanboy. Die ganze Band habe ich leider erst 2009 bei ihrer Reunion live gesehen – wobei der Bezug auf meine erste Platte bei der „Return to Eden“ Tour natürlich die Reminiszenz schlechthin war. Ihre letzte Tour zum „U-VOX“ Album im Winter 86/87 verpasste ich, weil unser Citroen GS es im Schneetreiben nicht aus dem Allgäu nach Stuttgart schaffte. Dafür habe ich nach der Auflösung alle Spin-offs weiter verfolgt: Billy Curries Alben wie „Transportation“ (1988) und auch die ganzen Solo-Konzerte von Midge Ure, die ohne den Genius seiner Mitstreiter am Ende nur noch etwas Singer-Songwriter-Charme hatten. Auch den historischen Wurzeln ging ich nach: die drei Alben mit John Foxx (unvergessen: die erste Scheibe mit „I Want To Be A Machine“) und dessen Solo-Platten, die Visage-Alben und natürlich Conny Plank, in dessen Studio nahe Köln (auf der Rückseite des Covers vermerkt) Rage In Eden entstanden ist. Ultravox hatte mich aus dem Paradies meiner Kindheit vertrieben, es führte kein Weg mehr zurück.
Gary Numan – Telekon (1980)
„I am the final silence“
 Ging es noch düsterer, deeper? Ja, denn auf meinem Weg entlang der Querverbindungen zu Ultravox kam ich schließlich auch bei Gary Numan vorbei, wo der ganze elektrische und emotionale Aufbruch zu einem autistischen Sägezahn-Dröhnen zusammenzufallen scheint: statisch, schräg, faszinierend. Niemand singt so wie Gary, weil er wie jemand klingt, der eigentlich gar nicht singen sollte. Und dass er es trotzdem tut, passt einfach genau zu den verqueren, düsteren Messages seiner Texte. Es gibt viele tolle Tracks auf dem Album „Telekon“ (This Wreckage, Remind Me To Smile), aber der Song vom Elektriker, der nach der Apokalypse von seinen Drähten träumt, ist heute noch so gut wie damals: ein Abgesang auf unseren technischen Fortschritt – erzeugt mit den damals fortschrittlichen elektronischen Musikinstrumenten Minimoog und Oberheim OB-Xa.
Ging es noch düsterer, deeper? Ja, denn auf meinem Weg entlang der Querverbindungen zu Ultravox kam ich schließlich auch bei Gary Numan vorbei, wo der ganze elektrische und emotionale Aufbruch zu einem autistischen Sägezahn-Dröhnen zusammenzufallen scheint: statisch, schräg, faszinierend. Niemand singt so wie Gary, weil er wie jemand klingt, der eigentlich gar nicht singen sollte. Und dass er es trotzdem tut, passt einfach genau zu den verqueren, düsteren Messages seiner Texte. Es gibt viele tolle Tracks auf dem Album „Telekon“ (This Wreckage, Remind Me To Smile), aber der Song vom Elektriker, der nach der Apokalypse von seinen Drähten träumt, ist heute noch so gut wie damals: ein Abgesang auf unseren technischen Fortschritt – erzeugt mit den damals fortschrittlichen elektronischen Musikinstrumenten Minimoog und Oberheim OB-Xa.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Talk Talk – Spirit Of Eden (1988)
„Everybody needs someone“
 Als die Achtziger langsam dem Ende entgegen gingen, wurde es schwierig für meinen Musikgeschmack. Euro Disco, Rock und Rap, mit denen ich nichts anfangen konnte, dominierten zunehmend die Hitparaden und die einst geliebten Interpreten verschwanden immer mehr in der Versenkung. Nur wenigen gelang es sich zu halten (wie z. B. Depeche Mode), noch wenigeren sich stilistisch fortzuentwickeln, relevant zu bleiben. Am Faszinierendsten fand ich die (leider nur kurze) Weiterentwicklung von Talk Talk, weil sie ihren Erfolg aus den Alben „It’s My Life“ (1984) und „The Colour of Spring“ (1986) für eine ungewöhnliche Wendung nach innen genutzt haben und damit das Zerbrechliche hinter dem Popheldentum herauskehrten. Als ich „Spirit Of Eden“ das erste Mal hörte, war ich beeindruckt, wie kompromisslos die Band ihren eigenen Weg verfolgt – ohne Rücksicht auf Charterfolg oder Erwartung der Fans. Das einzige, was zu zählen scheint, ist Ausdruck. Und der entsprach meinem eigenen Gefühl des Unangepasstseins, das nicht mehr von einer breiten gesellschaftlich-musikalischen Strömung getragen wird. Dass die britische Band mit den atmosphärischen Klängen dieses Albums gleich noch die Blaupause für den kommenden Post-Rock geschaffen hatte, zeigt wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben (oder zu werden) – auch wenn das, was rauskommt, nicht dem entspricht, was gerade angesagt ist. Musik zum Ein- und Abtauchen.
Als die Achtziger langsam dem Ende entgegen gingen, wurde es schwierig für meinen Musikgeschmack. Euro Disco, Rock und Rap, mit denen ich nichts anfangen konnte, dominierten zunehmend die Hitparaden und die einst geliebten Interpreten verschwanden immer mehr in der Versenkung. Nur wenigen gelang es sich zu halten (wie z. B. Depeche Mode), noch wenigeren sich stilistisch fortzuentwickeln, relevant zu bleiben. Am Faszinierendsten fand ich die (leider nur kurze) Weiterentwicklung von Talk Talk, weil sie ihren Erfolg aus den Alben „It’s My Life“ (1984) und „The Colour of Spring“ (1986) für eine ungewöhnliche Wendung nach innen genutzt haben und damit das Zerbrechliche hinter dem Popheldentum herauskehrten. Als ich „Spirit Of Eden“ das erste Mal hörte, war ich beeindruckt, wie kompromisslos die Band ihren eigenen Weg verfolgt – ohne Rücksicht auf Charterfolg oder Erwartung der Fans. Das einzige, was zu zählen scheint, ist Ausdruck. Und der entsprach meinem eigenen Gefühl des Unangepasstseins, das nicht mehr von einer breiten gesellschaftlich-musikalischen Strömung getragen wird. Dass die britische Band mit den atmosphärischen Klängen dieses Albums gleich noch die Blaupause für den kommenden Post-Rock geschaffen hatte, zeigt wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben (oder zu werden) – auch wenn das, was rauskommt, nicht dem entspricht, was gerade angesagt ist. Musik zum Ein- und Abtauchen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Dead Can Dance – A Passage In Time (1991)
Spiritchaser
 Musikalisch war ich selbst in den Untergrund abgetaucht. Ganze Wochenenden verbrachte ich im Keller und bearbeitete bis zur Erschöpfung mein Schlagzeug in unserer Dark-Wave-Band „Spirit Of Bela“. Wenn wir dann nach Stunden für ein paar entspannende Sportzigaretten wieder oben auftauchten und unsere Session-Recordings durchgehört hatten, wurde auch mal die eine oder andere ausgewählte Scheibe zur Inspiration aufgelegt. So lernte ich Dead Can Dance kennen. Das erste, selbst betitelte Album riss mich ehrlich gesagt noch nicht vom Hocker, sondern reihte sich recht gleichberechtigt in die Riege anderer Bands wie Bauhaus, Fields of the Nephelim oder New Model Army ein, die wir damals hörten. Das änderte sich schlagartig mit „Within The Realm Of A Dying Sun“ (1987), das mit minimalistischen Rhythmen, magisch-repetitiven, an Philip Glass erinnernden Melodien und den elegischen Stimmen von Brendan Perry und Lisa Gerrard unglaubliche Atmosphären erzeugt. Der Versuch, etwas Erhabenes, ja womöglich Heiliges mit den Mitteln der Musik zu schaffen, blieb lange Jahre wegweisend für mich. Ich war DCD-Fan bis weit über die 90er-Jahre hinaus und schätzte sowohl bei „Into The Labyrinth“ (1993) als auch bei „Spiritchaser“ (1996), dass sie mit ihrem künstlerischen Ansatz wie Leuchttürme so wunderbar aus dem ansonsten recht verschlissenen Ethno-Pop-Gedöns herausragen. Die ersten Minuten des 3. Jahrtausends beging ich übrigens mit „Host Of Seraphim“ aus The Serpent’s Egg (1988), bei dem ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn die feierliche Melodie den Wechsel des anfangs lang gehaltenen Orgelpunkts bewirkt.
Musikalisch war ich selbst in den Untergrund abgetaucht. Ganze Wochenenden verbrachte ich im Keller und bearbeitete bis zur Erschöpfung mein Schlagzeug in unserer Dark-Wave-Band „Spirit Of Bela“. Wenn wir dann nach Stunden für ein paar entspannende Sportzigaretten wieder oben auftauchten und unsere Session-Recordings durchgehört hatten, wurde auch mal die eine oder andere ausgewählte Scheibe zur Inspiration aufgelegt. So lernte ich Dead Can Dance kennen. Das erste, selbst betitelte Album riss mich ehrlich gesagt noch nicht vom Hocker, sondern reihte sich recht gleichberechtigt in die Riege anderer Bands wie Bauhaus, Fields of the Nephelim oder New Model Army ein, die wir damals hörten. Das änderte sich schlagartig mit „Within The Realm Of A Dying Sun“ (1987), das mit minimalistischen Rhythmen, magisch-repetitiven, an Philip Glass erinnernden Melodien und den elegischen Stimmen von Brendan Perry und Lisa Gerrard unglaubliche Atmosphären erzeugt. Der Versuch, etwas Erhabenes, ja womöglich Heiliges mit den Mitteln der Musik zu schaffen, blieb lange Jahre wegweisend für mich. Ich war DCD-Fan bis weit über die 90er-Jahre hinaus und schätzte sowohl bei „Into The Labyrinth“ (1993) als auch bei „Spiritchaser“ (1996), dass sie mit ihrem künstlerischen Ansatz wie Leuchttürme so wunderbar aus dem ansonsten recht verschlissenen Ethno-Pop-Gedöns herausragen. Die ersten Minuten des 3. Jahrtausends beging ich übrigens mit „Host Of Seraphim“ aus The Serpent’s Egg (1988), bei dem ich heute noch Gänsehaut bekomme, wenn die feierliche Melodie den Wechsel des anfangs lang gehaltenen Orgelpunkts bewirkt.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
The Young Gods – TV Sky (1992)
„Gonna find out where you hide“
 Die Klangwelten weiteten sich in den 90er-Jahren und natürlich wollte ich mit dabei sein. Der Sampler schien es möglich zu machen, jedes Instrument spielen zu können, und so kratzte ich all mein Geld zusammen, um mir einen Ensoniq ASR-10 im Vollausbau (16 MB Speicher und SCSI-Wechselplattenlaufwerk) zu kaufen. Nun endlich würde nichts mehr zwischen mir und der ganzen Welt der Musik stehen, wie sie beispielsweise durch Yello, seit „You Gotta Say Yes To Another Excess“ (1983) eines meiner soundtechnischen Vorbilder, so plastisch auf Aufnahmen gebannt worden war. Eine völlig andere Schweizer Band war es aber, die mir ein Schlüsselerlebnis verschaffte, indem sie zeigte, was mit dem Sampler sonst noch möglich war: In der Stuttgarter „Röhre“ brannte die Hütte und vorne standen „The Young Gods“ – drei Menschen mit minimaler Ausstattung: ein ekstatischer Sänger am Mikrofon, ein ultrafitter und tighter Drummer und ein Typ mit „meinem“ ASR-10. Die ganze Instrumentierung bis hin zu Sisters of Mercy-artigen Gitarrenriffs kam aus diesem Gerät, spannte nur von den Drums getragen die musikalischen Bögen auf und bildete so die Basis für die Performance des Sängers, der sich darüber entfalten konnte wie weiland Jim Morrison bei „The End“ (vgl. Track „Summer Eyes“) – ich war beeindruckt und wieder mal zurück auf meine Post-Punk-Wurzeln verwiesen.
Die Klangwelten weiteten sich in den 90er-Jahren und natürlich wollte ich mit dabei sein. Der Sampler schien es möglich zu machen, jedes Instrument spielen zu können, und so kratzte ich all mein Geld zusammen, um mir einen Ensoniq ASR-10 im Vollausbau (16 MB Speicher und SCSI-Wechselplattenlaufwerk) zu kaufen. Nun endlich würde nichts mehr zwischen mir und der ganzen Welt der Musik stehen, wie sie beispielsweise durch Yello, seit „You Gotta Say Yes To Another Excess“ (1983) eines meiner soundtechnischen Vorbilder, so plastisch auf Aufnahmen gebannt worden war. Eine völlig andere Schweizer Band war es aber, die mir ein Schlüsselerlebnis verschaffte, indem sie zeigte, was mit dem Sampler sonst noch möglich war: In der Stuttgarter „Röhre“ brannte die Hütte und vorne standen „The Young Gods“ – drei Menschen mit minimaler Ausstattung: ein ekstatischer Sänger am Mikrofon, ein ultrafitter und tighter Drummer und ein Typ mit „meinem“ ASR-10. Die ganze Instrumentierung bis hin zu Sisters of Mercy-artigen Gitarrenriffs kam aus diesem Gerät, spannte nur von den Drums getragen die musikalischen Bögen auf und bildete so die Basis für die Performance des Sängers, der sich darüber entfalten konnte wie weiland Jim Morrison bei „The End“ (vgl. Track „Summer Eyes“) – ich war beeindruckt und wieder mal zurück auf meine Post-Punk-Wurzeln verwiesen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Bill Lasswell et.al. – Lost In The Translation (1994)
Neue Axiome
 Zu jeder guten Best-of gehört meiner Meinung nach ein Geheimtipp. Hier ist einer. Die CD kaufte ich blind im Frankfurter WOM allein aufgrund ihres Titels und der Tatsache, dass es sich um einen US-Direktimport handelte. Nicht einmal der Name Bootsy Collins sagte mir etwas und vom New Yorker Tausendsassa Bill Lasswell hatte ich noch nie gehört. Der Auslöser war das „Ambient“ im Namen des Labels. Ich hörte damals viel Ambient und versuchte mich selbst ausgiebig daran, beispielsweise an der „Vertonung“ eines Waldes unter Zuhilfenahme von Samples, die ich mit einem MD-Recorder vor Ort eingefangen hatte. Was ich auf „Lost in the Translation“ fand, war mir aber noch nie gelungen. Die Selected Ambient Works von Aphex Twin beispielsweise lösten eher klaustrophobische Gefühle bei mir aus; sie klangen wie aus dem Inneren technischer Geräte, wie mein eigenes Zeug, dem meiner Meinung nach der Raum fehlte. Ganz anders dieses Album: Hier war Offenheit, hier war Welt eingefangen. Vor allem liebe ich den Track „Cosmic Trigger“ mit seinen phantastisch ausladenden Streicher-Synth-Arrangements, die ein Gefühl vermitteln, als würde man in Wolken schweben. Die Momente von Geschwindigkeit, abwechselnd mit Passagen der Ruhe, auf die dann plötzlich kurze dissonant erscheinende Einsätze folgen und das Stück weiter tragen: Das ist Filmmusik, die so plastisch ist, dass sie keinen Film mehr braucht.
Zu jeder guten Best-of gehört meiner Meinung nach ein Geheimtipp. Hier ist einer. Die CD kaufte ich blind im Frankfurter WOM allein aufgrund ihres Titels und der Tatsache, dass es sich um einen US-Direktimport handelte. Nicht einmal der Name Bootsy Collins sagte mir etwas und vom New Yorker Tausendsassa Bill Lasswell hatte ich noch nie gehört. Der Auslöser war das „Ambient“ im Namen des Labels. Ich hörte damals viel Ambient und versuchte mich selbst ausgiebig daran, beispielsweise an der „Vertonung“ eines Waldes unter Zuhilfenahme von Samples, die ich mit einem MD-Recorder vor Ort eingefangen hatte. Was ich auf „Lost in the Translation“ fand, war mir aber noch nie gelungen. Die Selected Ambient Works von Aphex Twin beispielsweise lösten eher klaustrophobische Gefühle bei mir aus; sie klangen wie aus dem Inneren technischer Geräte, wie mein eigenes Zeug, dem meiner Meinung nach der Raum fehlte. Ganz anders dieses Album: Hier war Offenheit, hier war Welt eingefangen. Vor allem liebe ich den Track „Cosmic Trigger“ mit seinen phantastisch ausladenden Streicher-Synth-Arrangements, die ein Gefühl vermitteln, als würde man in Wolken schweben. Die Momente von Geschwindigkeit, abwechselnd mit Passagen der Ruhe, auf die dann plötzlich kurze dissonant erscheinende Einsätze folgen und das Stück weiter tragen: Das ist Filmmusik, die so plastisch ist, dass sie keinen Film mehr braucht.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Emmanuel Top – Acid Phase (1994)
Neue Erfahrungen
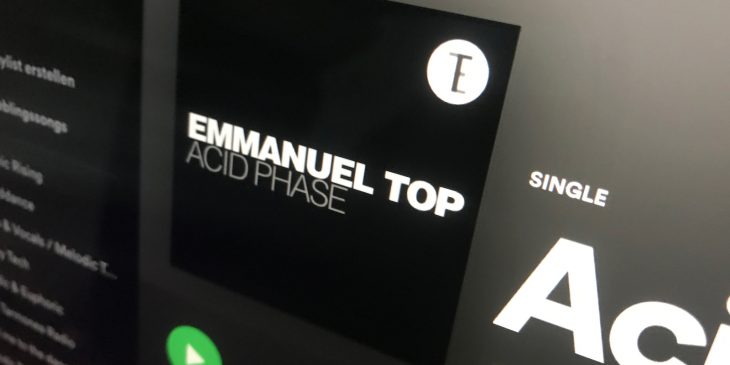 Dies hier ist kein Album, richtig, aber irgendwann hatte sich die Idee des Albums sowieso schon ein Stück weit verloren. Seit Anfang der 90er gab es stattdessen vermehrt Mixtapes aus Singles und EPs zu hören. Und es gab DJ-Sets – die Interessantesten natürlich in Berlin. Als Techno losging, interessierten niemanden die Namen der Artists, nicht mal die der DJs. Das Erlebnis des eigenen, gerne drogengeschwängerten Ichs und die Momente eines flüchtigen Wir-Gefühls auf der Tanzfläche waren zu wichtig, als dass dafür Platz gewesen wäre. Der Kitkatclub in der Glogauer Straße war so ein Ort, an dem alles möglich war. Viel Aufmerksamkeit konnte der DJ nicht erwarten bei dem wilden Treiben, das hier an allen Ecken für Adrenalin-Kicks sorgte. Und doch gab es immer irgendwann einmal einen Sound, der herausstach, weil man ihn noch nicht gehört hatte und der die Atmosphäre des Anything goes noch verstärkte. Ein solcher war das „Bow-bow“ der TB-303. Was für ein Track das war, habe ich erst später herausgefunden. Egal. Mich beamt er jedenfalls nach wie vor zurück in diesen dunklen Keller mit den neonbunten Figuren an der Wand und den abenteuerlichen, abenteuerlustigen Gestalten im Raum. Yeah!
Dies hier ist kein Album, richtig, aber irgendwann hatte sich die Idee des Albums sowieso schon ein Stück weit verloren. Seit Anfang der 90er gab es stattdessen vermehrt Mixtapes aus Singles und EPs zu hören. Und es gab DJ-Sets – die Interessantesten natürlich in Berlin. Als Techno losging, interessierten niemanden die Namen der Artists, nicht mal die der DJs. Das Erlebnis des eigenen, gerne drogengeschwängerten Ichs und die Momente eines flüchtigen Wir-Gefühls auf der Tanzfläche waren zu wichtig, als dass dafür Platz gewesen wäre. Der Kitkatclub in der Glogauer Straße war so ein Ort, an dem alles möglich war. Viel Aufmerksamkeit konnte der DJ nicht erwarten bei dem wilden Treiben, das hier an allen Ecken für Adrenalin-Kicks sorgte. Und doch gab es immer irgendwann einmal einen Sound, der herausstach, weil man ihn noch nicht gehört hatte und der die Atmosphäre des Anything goes noch verstärkte. Ein solcher war das „Bow-bow“ der TB-303. Was für ein Track das war, habe ich erst später herausgefunden. Egal. Mich beamt er jedenfalls nach wie vor zurück in diesen dunklen Keller mit den neonbunten Figuren an der Wand und den abenteuerlichen, abenteuerlustigen Gestalten im Raum. Yeah!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Tortoise – TNT (1998)
Post-Rock, Pre-2K
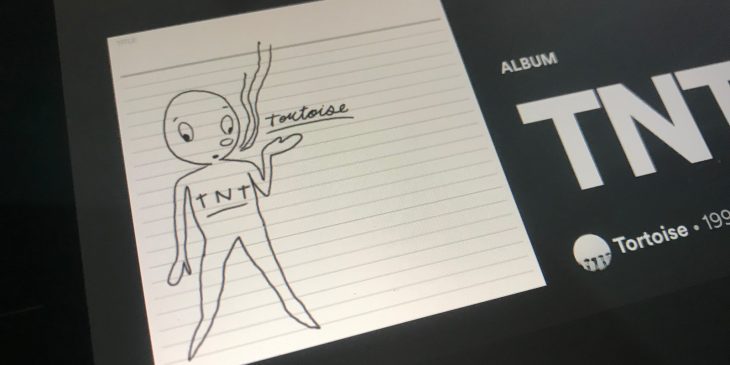 Als sich das alte Jahrtausend ganz undramatisch dem Ende entgegen neigte, wurde in Berlin der ewige Kanzler Kohl von Rot-Grün abgelöst und man konnte sich nicht nur Hoffnung auf ein progressiveres Gesellschaftsklima (mitsamt Legalisierung von Marihuana) machen, sondern auch auf schnelles Geld in einer boomenden digitalen Kreativwirtschaft – bevor sich alles wieder in Krieg, Terror und dem Platzen der „Dotcom-Blase“ auflösen sollte. In diesem offenen, kosmopolitischen Moment war plötzlich Raum, um sich sogar mit intellektuellen US-amerikanischen Jazzrockern zu beschäftigen. Jedenfalls wenn sie ihr Instrumentarium ungewöhnlich kombinierten und mit ein paar Synthies aufpeppten. Diese durften dann gerne auch billig, hohl und digital klingen, wie es damals stark in Mode war (siehe die Alben von Mouse on Mars oder später The Notwist), schließlich waren die Geräte wie z. B. Rolands MC-303, die wir für unsere Kopfhörer-Wohnzimmer-Sessions verwendeten, auch nicht gerade die Beeindruckendsten. Was dieses Album für mich besonders machte, war aber, dass es eben nicht nach Studentenmukke klingt (schließlich war ich nun bereits in meinen Dreißigern), sondern mit echtem Könnertum verbunden ist. Das hört und sieht man wunderbar in der 21 Jahre später aufgenommenen Live-Version. Mich hat der Sound dieser Zeit inspiriert, im Taucheranzug mit meiner Wavedrum im Fernsehen aufzutreten, noch offener für Crossover aller Art zu werden und mich zu professionalisieren (Jazzschool, eigenes Album), auch wenn ich am Ende dann doch – wie so viele – nur im E-Commerce gelandet bin.
Als sich das alte Jahrtausend ganz undramatisch dem Ende entgegen neigte, wurde in Berlin der ewige Kanzler Kohl von Rot-Grün abgelöst und man konnte sich nicht nur Hoffnung auf ein progressiveres Gesellschaftsklima (mitsamt Legalisierung von Marihuana) machen, sondern auch auf schnelles Geld in einer boomenden digitalen Kreativwirtschaft – bevor sich alles wieder in Krieg, Terror und dem Platzen der „Dotcom-Blase“ auflösen sollte. In diesem offenen, kosmopolitischen Moment war plötzlich Raum, um sich sogar mit intellektuellen US-amerikanischen Jazzrockern zu beschäftigen. Jedenfalls wenn sie ihr Instrumentarium ungewöhnlich kombinierten und mit ein paar Synthies aufpeppten. Diese durften dann gerne auch billig, hohl und digital klingen, wie es damals stark in Mode war (siehe die Alben von Mouse on Mars oder später The Notwist), schließlich waren die Geräte wie z. B. Rolands MC-303, die wir für unsere Kopfhörer-Wohnzimmer-Sessions verwendeten, auch nicht gerade die Beeindruckendsten. Was dieses Album für mich besonders machte, war aber, dass es eben nicht nach Studentenmukke klingt (schließlich war ich nun bereits in meinen Dreißigern), sondern mit echtem Könnertum verbunden ist. Das hört und sieht man wunderbar in der 21 Jahre später aufgenommenen Live-Version. Mich hat der Sound dieser Zeit inspiriert, im Taucheranzug mit meiner Wavedrum im Fernsehen aufzutreten, noch offener für Crossover aller Art zu werden und mich zu professionalisieren (Jazzschool, eigenes Album), auch wenn ich am Ende dann doch – wie so viele – nur im E-Commerce gelandet bin.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Peter Gabriel – Scratch My Back (2010)
„Set my spirit free“
 Die großen Gefühle und großen Konzerte blieben derweilen den Stars vorbehalten, von denen die meisten schon lange im Geschäft waren. Manche hatte ich bislang übersehen. So war es eine Überraschung, als ich bei einem Open Air am Münchner Königsplatz Anfang der 00er-Jahre, das ich eigentlich nur wegen Bryan Ferry besucht hatte, erleben konnte, wie Peter Gabriel das Konzert mit „Here Comes The Flood“ allein am Piano beendet. Dieser Typ, der mir seit „Sledgehammer“ als anstrengender Pop-Fuzzi gegolten hatte und entsprechend all die Jahre ignoriert worden war, war ja in Wirklichkeit ein Magier der Musik. Ich war beeindruckt vom kurz darauf erschienenen „Up“ (2002, immer noch wunderbar: „My head sounds like that“) und der zugehörigen Show, aber ausgerechnet das Cover-Album „Scratch My Back“ (2010) wurde mein treuer Freund und Begleiter in persönlich sehr schwierigen Zeiten. Das liegt neben Peter Gabriels unvergleichlicher Stimme und Ausstrahlung vor allem an John Metcalfes Arrangements dieser tollen Songs von Bowie, Elbow, Talking Heads, Radiohead und Arcade Fire, die so modern klingen, wie dies mit klassischen Instrumenten nur möglich ist. Vielleicht war es gerade die Tatsache, dass mir dieses Instrumentarium selbst nicht zur Verfügung stand, die es mir ermöglichte, trotz aller eigenen musikalischen Erfahrungen wieder ganz in die Rolle des unbefangenen Zuhörers zu schlüpfen und mich, ganz Ohr, ganz Konsument, auf diese emotionale Reise mitnehmen zu lassen.
Die großen Gefühle und großen Konzerte blieben derweilen den Stars vorbehalten, von denen die meisten schon lange im Geschäft waren. Manche hatte ich bislang übersehen. So war es eine Überraschung, als ich bei einem Open Air am Münchner Königsplatz Anfang der 00er-Jahre, das ich eigentlich nur wegen Bryan Ferry besucht hatte, erleben konnte, wie Peter Gabriel das Konzert mit „Here Comes The Flood“ allein am Piano beendet. Dieser Typ, der mir seit „Sledgehammer“ als anstrengender Pop-Fuzzi gegolten hatte und entsprechend all die Jahre ignoriert worden war, war ja in Wirklichkeit ein Magier der Musik. Ich war beeindruckt vom kurz darauf erschienenen „Up“ (2002, immer noch wunderbar: „My head sounds like that“) und der zugehörigen Show, aber ausgerechnet das Cover-Album „Scratch My Back“ (2010) wurde mein treuer Freund und Begleiter in persönlich sehr schwierigen Zeiten. Das liegt neben Peter Gabriels unvergleichlicher Stimme und Ausstrahlung vor allem an John Metcalfes Arrangements dieser tollen Songs von Bowie, Elbow, Talking Heads, Radiohead und Arcade Fire, die so modern klingen, wie dies mit klassischen Instrumenten nur möglich ist. Vielleicht war es gerade die Tatsache, dass mir dieses Instrumentarium selbst nicht zur Verfügung stand, die es mir ermöglichte, trotz aller eigenen musikalischen Erfahrungen wieder ganz in die Rolle des unbefangenen Zuhörers zu schlüpfen und mich, ganz Ohr, ganz Konsument, auf diese emotionale Reise mitnehmen zu lassen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Stephan Bodzin – Powers Of Ten (2015)
Techno singularity
 Auch jenseits des Pop haben Musiker intensiv an Soundtechniken weitergearbeitet, am stärksten und kompromisslosesten wohl im Techno, der in diesem Jahrhundert schon viele Metamorphosen durchgemacht hat (Trance, Goa, Ibiza, Minimal, Melodic …). Nachdem ich Mitte der 10er-Jahre mit NIs Maschine musikalisch wieder aktiv wurde, arbeitete ich mich parallel auch durch die unzähligen Erzeugnisse elektronischer Tanzmusik, wo ich fast keinen Act mehr kannte, und ließ auch Nischengenres wie Psy (Tipp: Loud – „5 Billion Stars“, 2016) nicht aus. Letztlich überzeugten mich Labels wie Drumcode (Enrico Sangiuliano – „Biomorph“, 2018) und Afterlife (Colyn, Innellea) vom Techno der melodischen Spielart. Nirgendwo sonst verbindet sich die Freude am Experimentieren so mit dem Tanzbaren und Eingängigen. Stephan Bodzin, Vollblutmusiker und langjähriger Weggefährte von Marc Romboy, dessen Masterclass ich in Zürich besuchen durfte, schafft es, die endlose Steigerung, die seit jeher zu Techno gehört (und die er als Performer selbst ekstatisch feiern kann) mit ganz minimalistischen Mitteln zu erreichen. Seine Stücke seit den Systematic-Veröffentlichungen haben aus dem alten Minimoog so vieles, auch bislang Unerhörtes herausgeholt, dass sie mir halfen, die Schönheit des klassischen Analogsounds wiederzuentdecken. Definitiv ging dies nicht nur mir so und vermutlich hat die Firma Moog diesem Künstler den Absatz etlicher Chargen ihres Subsequent-37 zu verdanken. Mit „Powers of Ten“ hat der Mann auf seinem Label Herzblut dann auch ein richtiges Album aufgelegt, das alle Facetten seiner künstlerischen Handschrift zeigt und dessen Abschluss „Wir“ so sanft und ätherisch klingt wie es für tanzbare Musik überhaupt möglich ist.
Auch jenseits des Pop haben Musiker intensiv an Soundtechniken weitergearbeitet, am stärksten und kompromisslosesten wohl im Techno, der in diesem Jahrhundert schon viele Metamorphosen durchgemacht hat (Trance, Goa, Ibiza, Minimal, Melodic …). Nachdem ich Mitte der 10er-Jahre mit NIs Maschine musikalisch wieder aktiv wurde, arbeitete ich mich parallel auch durch die unzähligen Erzeugnisse elektronischer Tanzmusik, wo ich fast keinen Act mehr kannte, und ließ auch Nischengenres wie Psy (Tipp: Loud – „5 Billion Stars“, 2016) nicht aus. Letztlich überzeugten mich Labels wie Drumcode (Enrico Sangiuliano – „Biomorph“, 2018) und Afterlife (Colyn, Innellea) vom Techno der melodischen Spielart. Nirgendwo sonst verbindet sich die Freude am Experimentieren so mit dem Tanzbaren und Eingängigen. Stephan Bodzin, Vollblutmusiker und langjähriger Weggefährte von Marc Romboy, dessen Masterclass ich in Zürich besuchen durfte, schafft es, die endlose Steigerung, die seit jeher zu Techno gehört (und die er als Performer selbst ekstatisch feiern kann) mit ganz minimalistischen Mitteln zu erreichen. Seine Stücke seit den Systematic-Veröffentlichungen haben aus dem alten Minimoog so vieles, auch bislang Unerhörtes herausgeholt, dass sie mir halfen, die Schönheit des klassischen Analogsounds wiederzuentdecken. Definitiv ging dies nicht nur mir so und vermutlich hat die Firma Moog diesem Künstler den Absatz etlicher Chargen ihres Subsequent-37 zu verdanken. Mit „Powers of Ten“ hat der Mann auf seinem Label Herzblut dann auch ein richtiges Album aufgelegt, das alle Facetten seiner künstlerischen Handschrift zeigt und dessen Abschluss „Wir“ so sanft und ätherisch klingt wie es für tanzbare Musik überhaupt möglich ist.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.









The Host of Seraphim ist ein Sakrament… so genial.
Gute Sachen dabei, Michael.
Immer wieder interessant, wie bei „gleichartigem“ Start, sich der Geschmack verzweigt speziaisiert, und trotzdem im Rückblick die gleichen Startpunkte genannt werden.
Sehr schöne Liste, Einiges ist Neuland für mich, aber sehr interessant…!
Bei Talk Talk werde ich immer noch weich, rangekommen ganz klassisch über „Such a shame“ und „Life’s what you make it“.
„Spirit of Eden“ hat ’ne Weile gebraucht, bis es mich gepackt hatte, das war schon eine andere Richtung als die vorherigen Geschichten.
Mein Favorit ist „I believe in you“, das bringt mich sogar heute noch ganz woanders hin…
Und Dein Fazit ist ein Gutes… :-)
@Codeman1965 Viel zu früh gegangen 😔😢
@Sven Rosswog leider. Ein genie.
Coole Liste,
Von Stephan Bodzin habe ich die ersten Platten auf Herzblut, Spielzeug und so….das war um 2005 plus minus 2 bis 3 Jahre eine unglaublich kreative Phase. Da hab ich auch viel Thomas Schuhmacher gekauft. Wollte deswegen auch ein Subsequent, habe aber nie die Sequenzen und Töne erzeugen können wie er.
Emmanuel Top ist natürlich auch mega. ich versuche schon seit eignen Jahren seine Longplayer zu beschaffen. Bisher scheitert es an den Gebrauchtmarktpreisen. Die stufenweisen Modulationen mag ich. Nicht Cutoff langsam rein oder rausdrehen, sondern nach 8 oder 16 Takten ein paar Stufen mehr. Erzeugt unglaubliche Energie. Stress ist so gemein. Coolste Verarbeitung eines Doors Samples in Turkish Bazar. Generell Melodien und Atmosphären ohne Kitsch in seinen Trance Stücken, wie Fusion. Hits mit Abfahrtcharakter.
Eine schöne Liste, Herr Kollege! Vor allem bei Dead Can Dance geht mir auch das Herz auf :-)
Klasse, dass SPIRIT OF EDEN dabei ist.
Für mich sind Talk Talk die wohl beste Band der 80iger aus UK.
Gute Liste, da bin ich auch ganz nah dabei! Dead Can Dance kann ich aber wirklich nie mehr hören, das ist für mich so ewig gestrig. Hab ich damals aber auch gehört ;)
Bis auf Emmanuel Top stimme ich dir bei keiner Pladde/ LP zu. Diesen Mist kannst du doch komplett verbrennen!
@Lambrusco Ali Musikgeschmack ist halt nicht immer mit dem eigenen kompatible😬Aber deshalb alles verbrennen ???
Super Liste!
Muss heut Abend auch mal wieder Spirit of Eden auflegen…
DCD hat sich leider ein bisschen selber verramscht, wie ich finde. So ist das aber vielleicht, wenn zwei so außergewöhnliche Künstler aufeinander treffen und man sich dann irgendwann menschlich entfernt. Es gab da mal irgendwo ein Interview mit Brendan Perry darüber.. habs verlegt.
Von Gary Numan find ich tatsächlich „Dance“ am spannendsten, es hat so eine 80s Neon-Film-Noir Atmosphäre.
Tortoise ist natürlich auch toll, mein Favorit ist „it’s all around you“, TNT ist natürlich auch klasse.
Sehr schöne Liste. Einige kenne ich noch nicht, hoffe ich werde bei meinem streamingdienst fündig. An Ultravox erinnere ich mich immer gerne, denn denen konnte ich beim Konzert in Berlin wunderbar bei einem Brummen der Gitarre helfen. Alle waren richtig tolle Typen und das Konzert einfach genial.
@efsieben Für alle Ultravox- (und Gary Numan-) Fans hier ein sehr ausführliches Interview mit Billy Curry:
https://www.electricityclub.co.uk/vintage-synth-trumps-with-billy-currie/
Es enthält nicht nur eine Menge Gear-Talk, also eigentlich Berichte über Billys Erfahrungen mit diversen Synthesizern dieser Ära. Es sind auch tolle YT-Videos inkludiert, z.B. die Drum-Performance aus dem „Monument“-Konzert, Billys Arp-Solo bei Numans „On Broadway“ und eine sehenswerte Aufzeichnung von „Young Savage“ im deutschen Fernsehen (angekündigt von dem jungen Thomas Gottschalk), bei der John Foxx die Bühne zerlegt ;-)