Hot Rodded CL 1B Clone
Inhaltsverzeichnis
Der Heritage Audio Tubesessor ist ein einkanaliger Opto-Kompressor, mit dem der spanische Hersteller von Retro-Equipment seine Produktpalette um einer weiteren Nachbau eines Studio-Standards vergrößert. Bei der Entwicklung des Tubesessors diente dieses Mal der Tube-Tech CL 1B als Vorlage, ein moderner Klassiker aus Dänemark, der bis heute in kleiner Stückzahl regulär produziert wird. Dessen Urversion kam 1987 auf den Markt und etablierte sich schnell in der Studio-Szene als flexibler Ersatz für den berühmten Teletronix LA-2A.
Heritage Audio hat diesen Topseller von Tube-Tech nicht einfach nur nachgebaut, sondern versucht, seine Version durch eigenständige Features hervorzuheben: Neben der Möglichkeit, vier verschiedene Sättigungsstufen der Röhrenschaltung zu nutzen, bietet der Tubesessor auch ein internes Sidechain-Filter, Custom-Übertrager und NOS-Röhren.
Heritage Audio Tubesessor auf den ersten Blick
Der Heritage Audio Tubesessor ist in einem robusten, 19 Zoll breiten Gehäuse aus Stahlblech mit drei Höheneinheiten untergebracht, sein Gewicht beträgt rund 3,6 kg. Rein optisch ähnelt er grob dem blauen Vorbild von Tube-Tech, nur mit einem ausgeprägteren Vintage-Design, das ein bisschen an einen Pultec Equalizer aus den 50er-Jahren erinnert. Rundum betrachtet wirkt die Verarbeitung sehr solide und auch alle Bedienelemente hinterlassen einen hochwertigen Eindruck.
Das übersichtlich gestaltete Frontpaneel ist mit schönen, großen Reglern versehen, die einen gesunden Abstand zueinander haben, so dass man beherzt zugreifen kann. Alle Potentiometer verfügen über einen leicht gerasterten Regelweg, wodurch ein Recall und der Abgleich mit einem zweiten Gerät für Stereoanwendungen vereinfacht werden sollte. Die fünf Drehregler erzeugen wiederum beim Betätigen einen ordentlichen Widerstand und lösen ein wohlklingendes, mechanisches Klacken aus.
Mittels eines Kippschalters wird das Gerät auf der rechten Seite eingeschaltet, worauf hin eine LED mit orangefarbiger, juwelförmiger Kappe zu schimmern beginnt. Direkt daneben liegt ein weiterer kleinerer Kippschalter für den Hardwire-Bypass. Sobald der Schaltkreis des Tubesessors aktiviert ist, fängt das darüber liegende, 7,5 x 3,2 cm große VU-Meter an zu leuchten. Wahlweise lässt sich mit dieser Nadelanzeige das Ein- und Ausgangssignal oder das Maß der Pegelreduktion kontrollieren.
Genau wie bei dem Vorbild von Tube-Tech, stehen zum Einstellen des Kompressors folgende Parameter zur Verfügung:
Ratio (2:1 bis 10:1), Threshold (bis -40 dB), Attack (0,5 bis 300 ms), Release (0,05 bis 10 s) und Gain (max. +30 dB) für die Aufholverstärkung. Auch die Regelzeiten sind mit denen des CL 1B identisch. Im Fixed-Setup (Attack 1 ms und Release 50 ms) können sie nicht verändert werden, während sie sich im manuellen Betrieb frei einstellen lassen. Ebenso ist aber auch eine Kombination mit festgelegter Einregelzeit und manuellem Release-Wert aufrufbar.
Abweichend von dem CL 1B besitzt der Tubesessor einen Regler für die Röhrensättigung, deren vier Stufen (Classic, Mild, Medium und Hot) in Abhängigkeit von der Aufholverstärkung für leichte bis starke Verzerrungen sorgen. Auch das bereits von dem Successor bekannte Sidechain-Filter hat Heritage Audio in den Tubesessor integriert. So lassen sich die Bässe ab 80 oder 160 Hz aus dem Detektorpfad entfernen, die oberen Mitten bei 1 oder 3 kHz mit einem Glockenfilter bearbeiten oder die Höhen ab 5 kHz aufwärts dämpfen.
Auf der Rückseite befindet sich noch der Kaltgeräteanschluss für das interne Netzteil sowie der Ein- und Ausgang für das Audiosignal im XLR Format von der Firma Neutrik. Per 6,3 mm Klinkenkabel kann eine Verbindung mit einem weiteren Tubesessor für Stereoanwendungen hergestellt werden, sofern auf der Vorderseite die Link-Funktion aktiviert ist.
Die Optozelle
Bei dem Tubesessor handelt es sich um einen Opto-Kompressor mit Röhrenausgangsverstärkung. Anfang der 60er-Jahre verwendete Jim Lawrence erstmalig eine solche Schaltung für den legendären LA-2A von Teletronix. Das Steuerelement dieser Kompressor-Art besteht aus einer Optozelle, deren Arbeitsweise auf folgendem Prinzip beruht:
Die Dynamik des anliegenden Audiosignals regelt die Stärke der Helligkeit einer Leuchtfolie. Gegenüber dieser Lichtquelle befindet sich wiederum ein Fotowiderstand, dessen Wert sich in Abhängigkeit zu der Lichtintensität verändert und so den Kompressor steuert.
Das klangliche Ergebnis eines Opto-Kompressors besitzt stets einen sehr angenehmen, musikalischen Charakter, der in seiner ursprünglichen Form ein eher gemächliches Regelverhalten an den Tag legt. Mit moderneren Schaltungen, in denen zum Beispiel LEDs verwendet werden, lassen sich schnellere Ergebnisse erzielen, was wohl auch bei dem Tubesessor der Fall ist.
Erstaunlicherweise erwähnt der Hersteller die Optozelle in keinem einzigen Satz – weder in der Produktbeschreibung, noch in den Demo-Videos, den Tec-Specs oder der Bedienungsanleitung. Auch auf Nachfrage hält Heritage Audio sich eher bedeckt und bestätigt lediglich, dass es sich um ein modernes Schaltungsdesign handelt, welches nicht einfach gegen eine andere Optozelle ausgetauscht werden kann. Unbeantwortet bleibt auch die Frage, ob sie selbstentwickelt wurde oder von einer externen Firma stammt. Gefertigt wird der Tubesessor in Spanien.
Die Bauweise des Heritage Audio Tubesessors
Wie bei dem CL 1B ist die Bauweise recht einfach gehalten: Direkt hinter dem Eingangsübertrager liegt die Opto-Schaltung, gefolgt von der Ausgangsstufe samt Transformator. Die „Tube Saturation“ Sektion weicht natürlich von dem Vorbild ab, da sie mit der Gain-Sektion zusammenarbeitet, um das Maß der Sättigung zu bestimmen.
Als Eingangsübertrager nutzt Heritage Audio einen AMI UT10 von TAB Funkenwerk. Die Firma des leider viel zu früh verstorbenen Masterminds Oliver Archut ist ein renommierter Hersteller von Ersatz-Transformatoren für Vintage-Equipment. So genießt auch der UT10 schon lange den Ruf eines authentischen und gleichwertigen Nachbaus des originalen UTC Transformators, der von Teletronix für den LA-2A verwendet wurde.
Für die Aufholverstärkung und Sättigungsstufen kommt eine NOS CK5755 Raytheon-Doppeltriodenröhre zum Einsatz, während in der Ausgangsstufe eine 12BH7A von Psvane sitzt. Beide Röhren sind leicht zugänglich auf der Rückseite des Tubesessors eingelassen, so dass sie sich bei Bedarf einfach wechseln lassen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Der Ausgangsübertrager besteht aus reinem Siliziumstahl, auch hierbei soll es sich um einen Custom-Transformator handeln, dessen Herkunft Heritage Audio aber ebenfalls nicht nennt.
Heritage Audio Tubesessor: Praxis im Tonstudio
Die Bedienung des Heritage Audio Tubesessors ist überaus simpel und weitestgehend selbsterklärend. Da die Skalierungen von Ratio, Attack und Release nur mit den niedrigsten und höchsten Werten beschriftet sind, muss stets per Gehör die passende Einstellung gefunden werden. Mit Hilfe eines vorübergehenden niedrigen Threshold-Wertes lässt sich das Regelverhalten allerdings gut wahrnehmen.
Dabei besticht der Tubesessor durch die für einen Opto-Kompressor typische Dynamikreduktion, welche selbst bei schnellen Ein- und Ausregelzeiten einen sehr entspannten Charakter hat. Gerade Gesangsaufnahmen – eine der beliebtesten Anwendungsbereiche des Tube-Tech CL 1B – profitieren von der angenehmen, unauffälligen Pegelangleichung. Die Ergebnisse wirken druckvoller, präsenter und lassen sich sehr einfach im Vordergrund einer Tonmischung einbetten, wobei sie stets offen und natürlich wirken. Ähnlich dem LA-2A sorgt der Tubesessor für eine ausgeprägte Färbung und betont die unteren Mitten und oberen Bässe, wodurch die Resultate immer etwas kräftiger und voluminöser klingen, insbesondere bei der Bearbeitung von E-Bässen.
Schon niedrige Kompressionswerte führen zu einer deutlich hörbaren Abrundung der Höhen und auch stärkere Verzerrungen tragen einen Teil zur Reduktion des Topends bei. Dieses Klangverhalten ist für einen analogen Kompressor mit Röhrentechnik weder ungewöhnlich noch schlimm – sofern man einen solchen Vintage-Sound mag. Wiederum kann eine nachträglich Anhebung der Höhen mit einem Equalizer von dem zuvor entstandenen Rolloff auf sehr schöne Weise profitieren.
Auch die Tube-Saturation Sektion ist ein vielseitiges und farbenfrohes Werkzeug, das sogar völlig losgelöst von dem Kompressor genutzt werden kann, wenn sich der Threshold-Regler in der Off-Position befindet. Für einen brillanten Ton ohne Verzerrung ist das Classic-Setting gedacht, bei dem die Ergebnisse sehr klar und transparent bleiben. Schrittweise lässt sich anschließend das Verzerrungsverhalten steigern, dank der zusätzlichen Abhängigkeit zu dem Gain-Regler bietet jede Stufe eine große Spanne zur Klanggestaltung. Diese reicht von subtilen Sättigungen mit schönen Obertönen bis hin zu starkem Overdrive, wobei die Ergebnisse stets einen angenehmen, kraftvollen, aber nicht beißenden Ton haben.
Abhängig von der Verzerrungsintensität erzeugt der Tubesessor natürlich zunehmend einen erhöhten Ausgangspegel, der je nach Aufnahmesetup nicht unproblematisch sein kann: Mit einem analogen Mischpult lässt die Lautstärke einfach kompensieren, wer allerdings mit einem Audiointerface direkt den Ausgang des Tubesessors abgreift, sollte zuvor die Konfiguration der Wandler überprüfen. Während des Tests reicht das Lo-Gain-Setting (+19 dBU @ 0 dBFS) des verwendeten RME Interfaces gerade so aus, um dem hohen Pegel standzuhalten. Glücklicherweise nimmt wie bei einem Röhren-Gitarrenverstärker die Lautstärke im oberen Highgain-Bereich ab einem gewissen Grad nicht weiter zu, während die Verzerrung sich dennoch verstärkt.
Etwas unausgewogen wirkt lediglich das Fixed-Setting, da es im Vergleich zu einer manuellen Einstellung mit ähnlichen Regelzeiten Verzerrungen in der Attack-Phase auslöst. Auf Nachfrage beim Hersteller heißt es, dass schnelle Regelzeiten bei zu starker Kompression für Übersteuerungen sorgen, insbesondere wenn das Signal einen kräftigen Bassanteil hat. Tatsächlich entstehen diese Verzerrungen bei dem Testgerät schon bei einer Pegelreduktion von 2-3 dB, selbst wenn zuvor per Sidechain-Filter die Bässe aus dem Signalweg entfernt wurden.
Klangbeispiele mit dem Opto-Kompressor
Während des Tests bestand leider keine Vergleichsmöglichkeit mit einem originalen CL 1B, der in den letzten Jahren wegen Bauteilengpässen nur in kleiner Stückzahl gefertigt wurde – daher muss der Tubesessor für sich sprechen. Auf Grund der minimalen Beschriftung der Regler werden die Einstellungen mit Uhrzeiger-Angaben beschrieben.
Alle Audiofiles sind wahlweise im WAVE-Format (44,1 kHz, 24 Bit) oder als MP3 (320 kBit/s) aufrufbar.
Male Vocal
Los geht es mit einer Gesangsspur von Mani Mathia, die ursprünglich mit einem Neumann U87 der ersten Generation, dem NE573 Preamp und 573EQ von IGS Audio aufgenommen wurde.
Nach der unbearbeiteten Version folgen drei Ausspielungen mit verschiedenen Sättigungsstufen (Clean, Medium und Hot), die aber alle die gleiche Kompressoreinstellung haben:
Kompressor-Einstellung: Attack 2 Uhr, Release 10 Uhr, Ratio 2 Uhr, durchschnittliche GR 3 dB, maximale GR 5 dB
Female Vocal
Als zweites Klangbeispiel ist eine Gesangsaufnahme von Isis Zerlett zu hören, die mit dem Rode NT1 durch einem Maihak V41 Röhrenvorverstärker aufgenommen und mit dem Millennia NSEQ-HF nachbearbeitet wurde.
Beide Ausspielungen sind ohne Sättigungseffekt, die erste hat eine manuelle Einstellung mit längerer Attack, die zweite nutzt das Fixed-Setting, in dem die bereits genannten, leichten Verzerrungen in den Einregelphasen entstehen. Um die Unterschiede gut wahrnehmen zu können, empfiehlt sich eine erhöhte Abhörlautstärke:
Kompressor-Einstellung:
– Beispiel 1: Attack 1 Uhr, Relase 11 Uhr, Ratio 11 Uhr, durchschnittliche GR 2-3 dB, maximale GR 5 dB, Classic clean
– Beispiel 2: Attack / Release: Fixed, Ratio 11 Uhr, durchschnittliche GR 2-3 dB, maximale GR 5 dB, Classic clean
Westerngitarre
Bei dem dritten Beispiel handelt es sich um die Aufnahme einer Westerngitarre, die mit einem U87 durch den Vorverstärker der Chandler Limited TG Microphone Cassette aufgezeichnet wurde. Die Nachbearbeitung erfolgte mit dem Summit Audio EQP-200B, dessen Entwickler Dave Hill übrigens leider kürzlich verstorben ist.
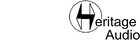

Wieder ist eine manuelle Einstellung und das Fixed-Setting zu hören:
Kompressor-Einstellung:
– Beispiel 1: Attack / Release Fixed, Ratio 1 Uhr, durchschnittliche GR 2 dB, maximale GR 3 dB, Classic clean, SC 160 Hz
– Beispiel 2: Attack 12 Uhr, Release 9 Uhr, Ratio 1 Uhr, durchschnittliche GR 2 dB, maximale GR 3 dB, Classic clean, SC 160 Hz
E-Bass
Als letztes Beispiel wird noch ein E-Bass mit dem Tubesessor bearbeitet, der für den Test des Rupert Neve Designs Shelford Channels aufgenommen und ebenfalls durch den EQP-200B geschickt wurde.
Nach einer Version ohne Sidechain-Filter, in der das Lowend etwas geringer ausfällt, folgt eine mit Sidechain-Filter bei 80 Hz und eine weitere Ausspielung mit zusätzlicher, leichter Sättigung:
Kompressor-Einstellung:
– Beispiel 1: Attack 10 Uhr, Relase 9 Uhr, Ratio 11 Uhr, durchschnittliche GR 2 – 3 dB, Classic clean
– Beispiel 2: Attack 10 Uhr, Relase 9 Uhr, Ratio 11 Uhr, durchschnittliche GR 2 – 3 dB, Classic clean, SC 80 Hz
– Beispiel 3: Attack 10 Uhr, Relase 9 Uhr, Ratio 11 Uhr, durchschnittliche GR 2 – 3 dB, Mild Saturation, SC 80 Hz
Klangbeispiele
Vocal 1:
Sänger: Mani Mathia
Mikrofon: Neumann U87
Vorverstärker: IGS Audio NE573
Equalizer: IGS Audio 573EQ
Vocal 2:
Sängerin: Isis Zerlett
Mikrofon: Rode NT1
Vorverstärker: Maihak V41
Equalizer: Millennia NSEQ-HF
Western-Gitarre:
Gitarre: Suzuki Three´s GW-15
Mikrofon: Neumann U87
Vorverstärker: Chandler Limited TG Microphone Cassette
Equalizer: Summit Audio EQP-200B
E-Bass:
E-Bass: Bogart 5-String Custom
Vorverstärker: Rupert Neve Designs Shelford Channel
Equalizer: Summit Audio EQP-200B
Audiointerface: RME Fireface 800
DAW: Logic Pro
Die Klangbeispiele sind unbearbeitet, nur die Lautstärken wurden angepasst.



















Sehr schöner sinnvoll gestalteter Beitrag.
Was den Artikel in meinen Augen besser und interessanter machen würde, wäre der direkte (und möglichst genaue Abgleich) mit dem Original (also z.B. Audiobeispiel xy mit den gleichen Einstellungen; Frequenzanalyse auf Unterschiede bei den gleichen Einstellungen usw.)
Versteh ich jetzt nicht, wieso man sich im Titel und Intro so stark auf den CL 1B bezieht, aber dann keinen Vergleich organisiert. Ist für mich dann irgendwie am Ziel vorbei..
Auf der Webseite von Heritage Audio wird das Wort Clone und auch der CL-1B nicht erwähnt. Er war sicherlich Ideenlieferant, mehr aber nicht.
Daher passt das Wort ‚Clone‘ in der Überschrift aus meiner Sicht nicht.
Ich sehe den Tubesessor als eigenständiges Gerät für den ich keinen Vergleich brauche. Die Klangbeispiele sind sehr aussagekräftig.
@Stratosphere Der sieht aber von Layout bis hin zur Netzleuchte schon sehr nach TubeTech aus.
@Stratosphere naja, wenn es nur als Ideenlieferant fungiert. Warum wird dann das Aussehen etc. übernommen?
Ein direkter Vergleich wäre nett gewesen. Wenn ich mir den Preis und die paar Features anschaue dann ist die Entscheidung leicht die paar Hundert Euro mehr zu bezahlen um das altbewährte Original zu kaufen,
den direkten Vergleich hätte ich auch gern gehört, trotzdem danke.