Das große Schwarze Metallica Kultalbum
Nein: 1991 war der Name Back In Black seit über einem Jahrzehnt vergeben und stand für einen der unangefochtenen Klassiker der Rockgeschichte. Außerdem hatte Metallica bereits 1988 ihre „Rückkehr in Schwarz“ gehabt – sie hieß And … Justice For All und war das erste Lebenszeichen der Band nach dem tragischen Unfalltod vom Bassisten und Publikumsliebling Cliff Burton. Man soll vielleicht Bandbiograf Mick Wall Kredit schenken, wenn er erzählt, dass Lars Ulrich, der die karikaturhafte Bildersprache der Metal-Welt jener Zeit satt hatte, sich für einen visuellen Weg starkmachte, der das krasse Gegenteil dazu darstellten sollte. Also, Aufgabe „Albumcover“: eine Farbe, darauf nur der Bandname; für einen Titel würde schon der Volksmund sorgen – hatte bei den Beatles prima funktioniert.
Diese Entscheidung soll damals zu einem frühen Zeitpunkt der Albumproduktion getroffen worden sein. Dass es für Metallica letztendlich auch funktionierte (und wie!), wissen wir heute alle. Wie sich die Band auf dem Weg dahin quasi neu erfand, erfahrt ihr in unserem Making Of Metallica „Black Album“.
Black Album – Hetfield, Ulrich, Hammet und Newsted
„Die einzige Top-10-Band, die du nicht auf MTV sehen wirst“. Oder war es „nicht im Radio hören wirst“? Nun, das Zitat kann auch die Daten-gierigste Suchmaschine nicht wiederfinden, aber damit betitelte Ende der 1980er Jahre eine amerikanische Zeitschrift (Rolling Stone? Creem? Kerrang!? Ach, der Autor kann sich an so viele Sachen aus der Zeit vor der Pandemie nicht mehr richtig erinnern …) eine Story über Metallica. Und die Überschrift brachte den Status der Band aus San Francisco einfach auf den Punkt: …And Justice For All (1988), ihr viertes Album, hatte das von der Band miterfundene Thrashmetal zwar in höhere Chartregionen gebracht, Radio-kompatibel war die Musik jedoch nicht geworden – zumindest nicht, um dem schrillen Charme der Glammetal-Bands ihren Platz im Äther strittig zu machen. Auch das Video zur dritten Single „One“, mit dem die Band ihrer Verweigerungstaktik gegenüber dem Musikfernsehen ein Ende setzte, sah in seiner Düsterkeit nicht so aus, als sei es für die berühmte heavy rotation gedacht.
Das Quäntchen Kompromisslosigkeit, das Metallica trotz wachsender Popularität behielt, hatte bisher geholfen, die Fans der ersten Stunde bei der Stange zu halten, aber bei James Hetfield (v, g), Lars Ulrich (d), Kirk Hammett (g) und Jason Newsted (b) machte sich ein gewisser Grad an Überdruss breit. Das Konzept verschlungener Songkonstrukte in epischer Länge stiftete bei ihnen bereits Langeweile und den Eindruck, dass es sich beim Publikum ähnlich verhielt. Zudem musste das Tandem Ulrich-Hetfield – Kopf bzw. Seele der Band -, das … And Justice For All de facto produziert hatte, auch eingestehen – wenn auch nur für sich -, dass dem Klang des Albums an Gewicht fehlte. Ein Manko, das man teilweise auf die törichte Vorgabe zurückzuführen ist, den Bass von „Newkid“ Newsted im Mix praktisch unhörbar zu machen.
Nach einer kleinen Serie europäischer Dates, die das … Justice-Kapitel endgültig abschlossen, gingen im Juni 1990 Hetfield und Ulrich in San Francisco an die Arbeit zum nächsten Album. Treffpunkt: Ulrichs Heimstudio; Grundstein: The Riff Tape, eine Kassette voller – hm – Riffs, die die Musiker im Laufe der gerade absolvierten Welttournee aufgenommen hatten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Gelegentlich stößt man im Leben auf seltsame Spiegel, die nicht das eigene Ebenbild, sondern das wiedergeben, was man zumindest ansatzweise sein möchte. Metallica wollten womöglich nie Mötley Crüe werden, aber sie waren schon sehr angetan vom Sound von Dr. Feelgood, als dieses Album 1989 die Rockwelt eroberte. Verantwortlich für das druckvolle Klangbild des Chartbreakers war der Kanadier Bob Rock, der nach einer erfolgreichen Karriere als Toningenieur (Loverboy, Bon Jovi, Aerosmith u. v. m.) zum Produzentenstuhl gewechselt und sich als solcher u. a. mit The Cult (Sonic Temple, 1989) und der Ein-Sommer-Sensation Kingdom Come (1988) bereits einen Namen gemacht hatte. Ein Wunsch-Mixer war gefunden, also rief das Metallica-Management bei Bob Rock an.
Bevor die Anfrage kam, hatte sich Rock – als einfacher Musikfan – bereits sowohl …Justice angehört als auch die Band live angesehen und war zu einem Urteil gekommen: Die Energie, die das Quartett auf der Bühne entfachte, war auf seinen Alben kaum vorhanden. Dies teilte er den Musikern bei den anschließenden Gesprächen schnörkellos mit, zusammen mit der Bedingung, er sei nicht am Abmischen, sondern nur am Produzieren interessiert. Ein klarer Affront vor allem für den Kontrollfreak Lars Ulrich (O-Ton: „Wir sind Metallica: Niemand produziert uns. Niemand sagt uns, was zu tun ist“). Am Ende ließ man sich doch auf eine Koproduktion ein – ein klares Zeichen dafür, dass sich die Band Großes von einer Zusammenarbeit mit Bob Rock versprach.
Metallica – Mit Bob Rock im Studio
Für den Arbeitsbeginn im Oktober 1990 hatten sich Metallica und ihr Produzent auf die One On One Recording Studios im kalifornischen North Hollywood geeinigt. Nun, „geeinigt“ will in diesem Fall heißen, es war eine Bedingung seitens der Band, der die Einrichtung seit der Arbeit an dem letzten Album bekannt/vertraut war. Für Bob Rock, der gewohnt war, ausschließlich in seinem Wohnort Vancouver zu arbeiten, bedeutete dies dagegen ein größerer Kompromiss. Immerhin: Dem eher unspektakulären Studio sagte man den „best drum-sounding room“ in den USA nach.
Wahrlich einig dagegen waren sich Musiker und Bob Rock bei ihrer Absicht, das immer wieder genannte live feel im Studio zu beschwören und einzufangen. Und dennoch: Was für Bob Rock die logische Herangehensweise bedeutete – sprich „die ganze Band spielt zusammen im Aufnahmeraum“ -, war für Hetfield & Co. mit einer steilen Lernkurve verbunden. Die bisherige Praxis brachte meistens nur den Drummer mit dem Sänger/Gitarristen zusammen, um am Aufbau der Rhythmusparts zu arbeiten; die Beteiligung der anderen Bandmitglieder erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dabei war die gewohnt präzise Rhythmusarbeit von James Hetfield der Faden, nach dem sich sein trommelnder Kollege orientierte.
Um die angestrebte neue Dynamik herbeizuführen, schlugen Bob Rock und sein kanadischer Landsmann und rechte Hand, Toningenieur Randy Staub, vor, Lars Ulrichs Spiel als Taktgeber ins Zentrum zu rücken und das – bitte schön – so direkt und frei von Schnörkeln wie möglich. Um es vereinfacht auszudrücken: Auf einmal musste Ulrich AC/DCs Phil Rudd mimen, nachdem er sich jahrelang auf das genaue Gegenteil vorbereitet hatte; dazu unter der Beobachtung eines peniblen Perfektionisten wie sein Produzent, der es gelegentlich für notwendig hielt, die Aufnahme bestimmter Passagen dutzendmal zu wiederholen. Denn mit „live feel“ meinte Bob Rock, die Band als Ensemble zum Einspielen bestmöglicher Performances zu fordern bzw. fördern – nicht von ganzen Stücken vom Anfang bis Ende, sondern von – O-Ton – „magical verses and choruses“. Nach der Auslese der musikalischen Puzzleteile wurden diese überwiegend von Randy Staub „into one magical track“ zusammengefügt, der erst durch die obligatorischen Overdubs von Gitarre, Bass und Gesang seine definitive Form annahm.
Allein diese Arbeit nahm die ersten drei Monate in Anspruch und brachte die Substanz mancher Materialien bis an ihre Grenzen: Die fisselige Schnippelei an den original 2-Zoll-Bändern hatte diese in einem so fragilen Zustand hinterlassen, dass man kurzum beschloss, den Inhalt in einen Sony 3224 24-Spur-Rekorder zu übertragen, aus Angst, die strapazierten Bänder nicht allzu oft abspielen zu können.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Als die Arbeit begann erste Früchte zu tragen, kamen die Musiker – vor allem die Entscheidungsträger Hetfield und Ulrich – langsam aus der Deckung ihrer anfänglichen Skepsis gegenüber Rocks Anregungen und Ansätzen. „Die Grundidee war, offen zu bleiben, wenn man uns neue Ideen präsentierte. Eine Menge großartiger Sachen auf dem Album stammen vom Nicht-nein-Sagen.“
Nach acht Monaten eines schleppenden, von Grundsatzdiskussionen und Hassliebe geprägten Aufnahmeprozesses, hatten alle Beteiligten genug voneinander, ungeachtet des gewachsenen Vertrauens und der vielversprechenden Ergebnisse. Jahre später reflektierte Bob Rock über die ausgelaugte Gefühlslage gen Ende der Produktion: “Es war keine einfache Platte zu machen. Natürlich hatten wir mal etwas zu lachen, aber alles war sehr schwierig. Als wir fertig waren, sagte ich den Jungs, dass ich nie wieder mit ihnen arbeiten würde. Ich glaube, sie fühlten dasselbe mir gegenüber.”
Das Abmischen des Black Album fand anschließend in den A&M Studios (Hollywood) statt. Am 8. Juli 1991, als Rock, Hetfield und Ulrich nach New York flogen, um mit George Marino am Mastering zu arbeiten, kam das Ende der Qual ein bisschen näher.
ESP und Gibson, aber auch Gretsch im Einsatz!
Die genaue Anzahl und Charakteristika der Instrumente zu ermitteln, die von der 4-bis-6-Saiten-Fraktion auf dem Black Album gespielt wurden, gestaltet sich mitunter etwas schwierig – massenhaft Zeug schleppten die Musiker und ihr Produzent während der monatelangen Produktionsarbeit ins Studio. Aber anhand verschiedener Interviews aus den letzten fast 30 Jahren (!) lässt sich zumindest eine Liste mit den Gerätschaften erstellen, die im Kern des opulenten Sounds – in manchen Fällen nur homöopathischen dosiert – wiederzufinden sind.
James Hetfield, der in den Jahren zuvor sein Bühnenimage vor allem mit verschiedenen Gibson-Explorer-Modellen etabliert hatte, wechselte zwar zum japanischen Hersteller ESP, blieb aber der asymmetrischen Korpusform treu und spielte fortan die mit aktiven EMG-81- bzw. -60-Tonabnehmern ausgestatteten MX-20-Modelle, unter ihnen die als „So Fucking What“ bekannte Klampfe in Weiß. Eine Gretsch White Falcon ist auf dem cleanen dive bomb in „Nothing Else Matters“ zu hören, obwohl ein 1988er Pro-AM-Modell aus der Edelgitarren-Schmiede Tom Anderson die Hauptrolle auf der Hit-Ballade spielte; unterstützt von einer 12-saitigen Danelectro in Olympic-White-Finish. Eine mit dem im Country-Milieu gern gesehene B-Bender ausgestattete Fender Telecaster fand auf „My Friend of Misery“ und „The Unforgiven“ ihren Platz.
Für die eher extravaganten Klangfarben sorgte eine türkisgrüne Jerry Jones Longhorn Baritone, die, unisono mit dem Bass gespielt, dem Riff von „Sad But True“ zu seinem Brontosaurus-schweren Charakter verhalf, während eine Vincent Bell Coral Sitar aus den 1960ern Jahren den orientalischen Flair des Riffs von „Where Ever I May Roam“ betonte.
In der Akustik-Abteilung standen Hetfield mindestens drei Instrumente zur Verfügung: eine Aria Nylon String Acoustic – ein Geschenk vom verstorbenen Freund Cliff Burton – und zwei 12-Saitige, nämlich eine Fender Shenandoah und eine Guild Jumbo.
Seine Verstärkerfestung bestand aus einem Mesa/Boogie Mark IIC++ aus den Mitt-80ern, einem von Jose Arrendondo (bekannt für seine Arbeit für Eddie Van Halen) modifizierten Marshall JCM800, einem Mesa/Boogie Mark IV, dem Vorverstärker ADA MP-1 und einem Mesa/Boogie Strategy 400 Power Amp. An Boxen kamen mehrere Marshall 1960B 4x12s mit Celestion-Vintage-30-Lautsprechern zum Einsatz. Eingestöpselt im externen Effektweg waren zwei Aphex EQF-2 EQs und ein Aphex CX-1 Compressor/Expander.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Kirk Hammett unterzog vor Beginn der Aufnahmen 15 Gitarren aus seiner Sammlung einer Art Tauglichkeitsprüfung. Am Ende überstanden das Prozedere folgende Instrumente: eine schwarze 1989er Gibson Les Paul Custom, eine 1961er Fender Stratocaster, eine 1953er Gibson ES-295 und zwei ESPs (jeweils ein LP-Junior- und ein Strat-Nachbau).
In Sachen Verstärkung entschied Hammet sich diesmal für eine neue Kombination: ein Bradshaw-Vorverstärker, eine VHT-Endstufe und 30-Watt-Marshall-Boxen. Für die cleanen Parts fiel die Wahl auf einen Fender Blackface Deluxe (gepaart mit der ‘61er Strat).
Kein Ibanez TS-9 diesmal, dafür aber ein altes VOX-Wah als einziges Pedal.
Jason Newsteds Bassarsenal war indes etwas unübersichtlicher – bis zu 25 verschiedene Bässe sollen im Studio gewesen sein; von 4- bis 12-Saitern, alles dabei. Unter ihnen befand sich sein damaliger Hauptinstrument, ein 1981er Spector NS-2, aber auch ein Music Man Stingray, ein Alembic Spoiler und ein Gibson Thunderbird. Als Verstärker kam nur der Ampeg-SVT-VR-Topteil seines Vertrauens zum Einsatz.
Black Album – Nothing Else Matters, eine Ballade
2011 wurde Bob Rock in einem Interview mit dem britischen MusicRadar auf seinen vermeintlichen Anteil am zugänglicheren Kompositionsansatz auf dem Black Album angesprochen. Rock wies jedwede Verantwortung von sich: „Als sie zu mir kamen, waren sie bereit für den Sprung in die ganz großen Ligen. Eine Menge Leute denkt, ich habe die Band verändert, was ich nicht tat. In ihren Köpfen hatten sie sich schon verändert, als ich sie traf.“
Wie dem auch sei, sein Input als Geburtshelfer des James Hetfield als Singer-Songwriter ist unüberhörbar; lasst es euch nicht von mir, sondern von Herrn Hetfield höchstpersönlich erzählen: „Ich wäre nicht da, wo ich heute stehe, ohne seine Bereitschaft, meinen Blick zu öffnen und mich dazu zu drängen, unterschiedliche Gesangsstile und Stimmungen auszuprobieren.“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
So wie es der Band bewusst war, die Möglichkeiten des Thrashmetal für sich ausgereizt zu haben, und dementsprechend am Überwinden der Genregrenzen arbeitete, so spürte Hetfield das Bedürfnis, sich als Songwriter weiterzuentwickeln. Mit großen (übergroßen?) Vorbildern wie John Lennon oder Bob Dylan im Visier und keinem ausgeprägten literarischen Hintergrund („Ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt, um Romane oder Poesie zu lesen; schöne kleine Gedichte schreibe ich auch nicht“) richtete Hetfield den Blick nach innen, in der Hoffnung, das eigene Seelenstriptease könnte auch andere Menschen berühren. Aus diesem neuen Standpunkt entstand „Nothing Else Matters“: 6/8-Takt, 70 bpm … die erste richtige Ballade der Band. Zwar wohnten Drama und Bombast dem Song inne, aber der Text deutete auf ein Liebeslied … in dem ausgerechnet das Wort „Liebe“ kein einziges Mal vorkommt. Allein dank dieses Merkmals konnte es sich von ähnlichen Kompositionen absetzen, mit denen andere Metalbands für die „ruhigen“ Momente aufwarteten.
Die Schlichtheit des Songs, der mit einem subtilen Orchesterarrangement von Michael Kamen unterlegt war, ließ zudem viel Raum für Hetfield, um neue Nuancen in seiner Stimme zu erkunden. Als Pate stand der delikate Vortrag von Schmusebarde Chris Isaak auf seinem Hit „Wicked Game“, der im Jahr davor Hetfields Aufmerksamkeit erregt hatte. Bob Rock lotste also den Sänger in die Welt des – hm – Singens, anders als die von Hetfield bevorzugte Methode des Zeile-für-Zeile-Aufnehmen und Doppeln.
Das Ergebnis des Experiments kennt man bereits. Und der Song, von dem sein Autor Angst hatte, es sei das Letzte, was seine Fans von der Band hören wollten, wurde zum festen Bestandteil des Live-Repertoires und gleichzeitig zum Evergreen der Rockmusik. So kann‘s gehen.
Metallica – Enter Sandman unter der Lupe
Judas Priests „You’ve Got Another Thing Comin'“, Megadeths „Symphony Of Destruction“ und – ja, das muss sein! – Quiet Riots „Bang Your Head“ – alle drei Vertreter des Heavy-Metal-Kanons mit bewährter Hit-Eigenschaften, in 4/4-Takt gehalten; eher Uptempo, ja, aber so, dass es noch ins Radio passt. Der Autor dieses Artikels kann nicht genug davon bekommen und ist dennoch der Meinung, dass „Enter Sandman“ alle drei vom Treppchen stößt und auf die Plätze verweist.
Das sich aufbauende Geflecht von cleanen und verzerrten Gitarren im Intro beschwört Bilder von Urängsten und Albtraumhaften, schon bevor der Gesang einsetzt (erst nach 1’10“ – wo gibt’s das noch?). Aber es braucht die Stimme eines James Hetfield in Bestform und mit seinem unwiderstehlichen Swag, um dieses Monument eines Rocksongs abzurunden. Nun, das und einen langen Weg.
Tatsächlich soll der Riff von „Enter Sandman“ die erste musikalische Zelle auf dem ergiebigen The Riff Tape gewesen sein, aus dem sich Hetfield und Ulrich fürs Songschreiben bedienten. Es war eine Idee von Kirk Hammett, der sie als „the heaviest thing I could think of“ beschrieb. Weil es gut, aber für die Hauptkomponisten offensichtlich nicht gut genug war, schlug Lars Ulrich vor, den zweiteiligen Riff auseinanderzunehmen und so wieder zusammenzusetzen, dass der erste Teil dreimal wiederholt und vom zweiten aufgelöst wird – da hatte jemand doch den richtigen Riecher.
Am 13. August wurde eine instrumentale Demoversion aufgenommen, aber erst während der Vorproduktion kamen die Struktur und Arrangements zustande, wie wir sie heute kennen. Und der Text? Nun, das Stück hatte bereits einen Titel, der seit einiger Zeit in Hetfields Notizbuch verweilte, aber noch keine vollständigen Lyrics. Als der Aufnahmeprozess bereits im fortgeschrittenen Stadium war, rückte der Sänger einen Text heraus, der sich auf sehr direkte Art und Weise mit dem Thema „Plötzlicher Kindstod“ beschäftigte und bei den Kollegen und Management nicht gerade für Entzücken sorgte. Also bekam Bob Rock die undankbare Aufgabe, noch einmal als Mentor aufzutreten und Hetfield zum Umschreiben zu motivieren – da hatte jemand doch den richtigen Riecher, Teil 2.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die Schwere von „Enter Sandman“ steht exemplarisch für die Klangarchitektur, die sich Produzent und Musiker für das Album erdachten, angefangen – natürlich – bei der Rhythmusgruppe. Um jeder Ecke des Aufnahmeraums das akustisch beste abzugewinnen und dabei den Bedingungen einer Live-Umgebung näher zu kommen, wurden das Schlagzeug und „The Tent of Doom“ (so nannte man intern den teils abgedeckten Verstärker-Turm von James Hetfield) mit über 40 strategisch platzierten Mikrofonen abgenommen. Laut Randy Staub wurden dann um die 50 Schlagzeugparts aufgenommen, um daraus den endgültigen Drumtrack zu konstruieren.
Jason Newsted seinerseits fand in Bob Rock einen bedingungslosen Unterstützer („als Rock dazu kam, erschienen auch die Bassfrequenzen“), der ihn bat, mehr wie ein Bassist als wie ein Gitarrist zu spielen – ein Ansatz, der zusammen mit der schlichteren Trommelarbeit von Lars Ulrich die Basis für einen anderen Groove bildete.
Gleich drei identische Rhythmusspuren ließ Rock James Hetfield mit seiner Gitarre aufnehmen, denen sich weitere mit verschiedenen Motiven (vom bekannten Wah-Solo ganz zu schweigen!) dazu gesellten – als möchte man das Verständnis von „wall of guitars“ unbedingt mit Sinn erfüllen.
Bereits als erste Single-Auskopplung festgelegt, wurde „Enter Sandman“ auch als Erstes abgemischt. Weil man auf der Suche nach dem perfekten Sound nie zu obsessiv sein kann, verschlang dieser Schritt die ersten 10 Mix-Tage (!) in den A&M Studios. Was lange währt …
Mit Dark Side Of The Moon gleichgezogen
Die Geschichte des Black Album ab seiner Veröffentlichung am 12. August 1991 lässt sich kurz wie die eines makellosen Triumphs erzählen.
Das neue Werk ging in Ländern auf allen Kontinenten auf die 1, am prominentesten natürlich in den USA und Großbritannien – der kleine Schönheitsfehler von „nur“ Platz 3 sei den japanischen Fans an dieser Stelle verziehen, zumal diese dann für fast eine halbe Million verkaufte Exemplare sorgten.
Die Fachpresse sprach ihrerseits mit praktisch einer positiven Stimme, die die Unterordnung von Speed- bzw. Thrashmetal-Elementen nicht als Zeichen von Ausverkauf oder gar Verweichlichung, sondern als Zeichen der Reife zu bewerten wusste.
In seiner 1991er Jahresbilanz „The year in guitar“ listete das Fachmagazin Guitar World das Black Album unter den besten Alben des Jahres gleich zweimal auf, und zwar jeweils in den Sparten „Metal“ und „Rock“ – eine eloquente Aussage in Sachen Anerkennung für die neue stilistische Offenheit der Band.
Irgendwann drang das Black Album auch in Dark-Side-Of-The-Moon-Terrain ein, spätestens nachdem es über 550 Wochen im Billboard-200-Chart verbracht hatte und die Verkaufszahlen sich 2016 – zum 25. Jubiläum, sozusagen – in einem Wochendurchschnitt von ca. 5.000 bewegten. Summa summarum belaufen sich die weltweiten Zahlen aktuell auf 22 Millionen (16 von ihnen nur in den USA) auf physikalischen Formaten. Dadurch gilt es als eines der bestverkauften Musikalben aller Zeiten – genreübergreifend. Und obwohl Metallica dadurch praktisch eine eigene Kategorie für sich erschuf, warf ihr immenser Erfolg auch ein helleres Licht auf das Werk ihrer am härtesten rockenden Kollegen, am Anfang eines Jahrzehnts, das auf eben diese Musik vorbereitet war.














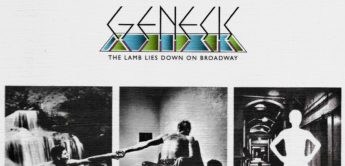

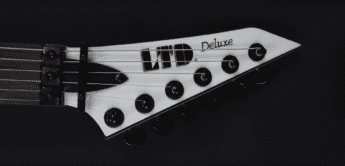
Toll Cristian. Klasse Party Album mit einer Portion Tiefgang :)
@TobyB Danke, Toby!
Party on, excellent!
@Cristian Elena Wir sind unwürdig^^
„Nothing Else Matters“, ja, ein guter Song.
Allerdings nervt mich extrem der Drum-Mix, speziell diese Basedrum klingt wie getriggertes Alesis D4, furztrocken in das ansonsten nette Ambiente gemischt,
Krampfhaft bemüht, im Kick hörbar zu sein, aber nicht eingebettet.
Find ich etwas sehr billig umgesetzt.
@vssmnn Nun, ein Drittel der angepeilten Mix-Zeit brauchten sie für „Enter Sandman“ und dann ging man vielleicht etwas schlampig mit dem einem oder dem anderen Stück um … ;-)
@vssmnn Argh… BASSdrum….. BASSdrum….
Toller Artikel für ein tolles Album! Habe ich in den 90ern wie so viele rauf und runter gehört und mit der Schulband nachgespielt.
War mir nicht bewusst, dass es so zusammengestückelt wurde – und das mit Bändern, oh weh…
Cuts ja, aber in dieser Dimension…
@Langsuan Danke für deine Rückmeldung, Langsuan!
Was das Zusammengestückelte angeht, nun: „es passiert in den besten Familien“ ;-) Im Fall vom „Black Album“ dürfte diese Praxis zu einer Kunstform für sich mutiert sein.
Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass es bei einer Metalband erst problematisch wird, wenn es konstruiert klingt. Neulich lief im Radio etwas, was in seiner klinischen Sauberkeit dermaßen nach Retorten-Metal klang (*kompositorisch auch keine Offenbarung) … Am Ende stellte sich heraus, es handelte sich um einen in den letzten … 10 Jahren? … ziemlich erfolgreichen Metal-Act (*den Namen behalte ich für mich), dessen Namen aber nicht ihre Musik mir bisher bekannt war. Ich war doch etwas irritiert.
Danke für den Bericht.
Ist echt eines der besten Alben, wenn es darum geht Leute aus verschiedenen Genres auf ner Party zu vergnügen. Bin auch froh hier noch die LP des Albums zu besitzen.
@Synthie-Fire Danke für deine Rückmeldung!
Das „Black Album“ könnte man in der Tat als „Konsensplatte der besseren Sorte“ betrachten“ – ich zumindest tue es! ;-)
„Into one magical track“ … hahaha … sehr schön formuliert, wenn die Wahrheit nicht dem Image entspricht.
Fakt war, dass das Schlagzeugspiel von Herrn Ulrich insbesondere in Sachen Timing bekanntermaßen so grottenschlecht war und ist, dass man 3 Monate lang jeden Kick-, Snare- und Tomschlag rucken musste, bis das Ergebnis erträglich war.
Metallica haben damals einen Trend gestartet, der heute faktisch auf jedem Rock- und Heavyalbum praktiziert wird.